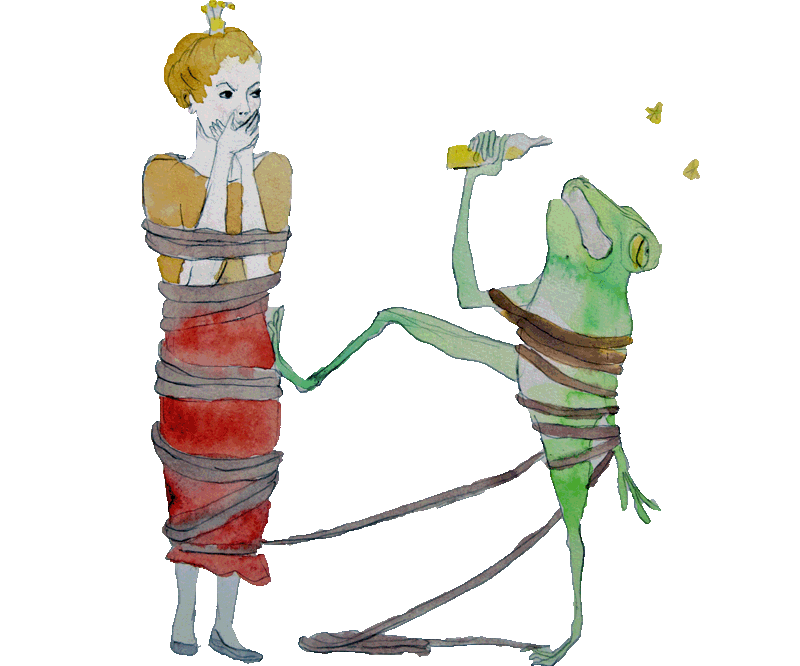
Archiv
Nachstehend finden Sie ältere Meldungen aus den Vorjahren zum Thema der Angehörigen und meinem Engagement in der Sache.

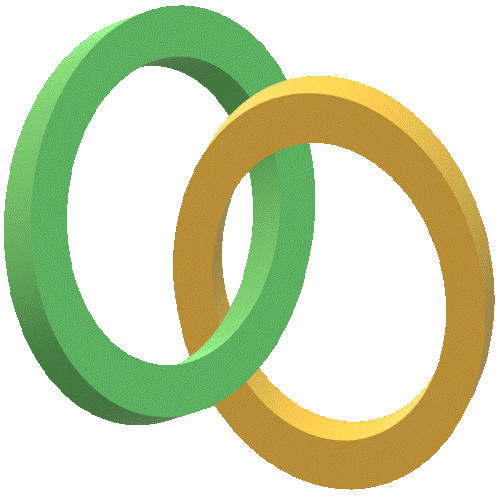
Süchtige klagen laut, Angehörige leiden still.
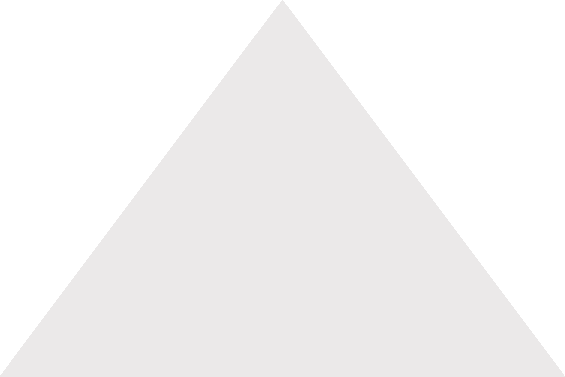
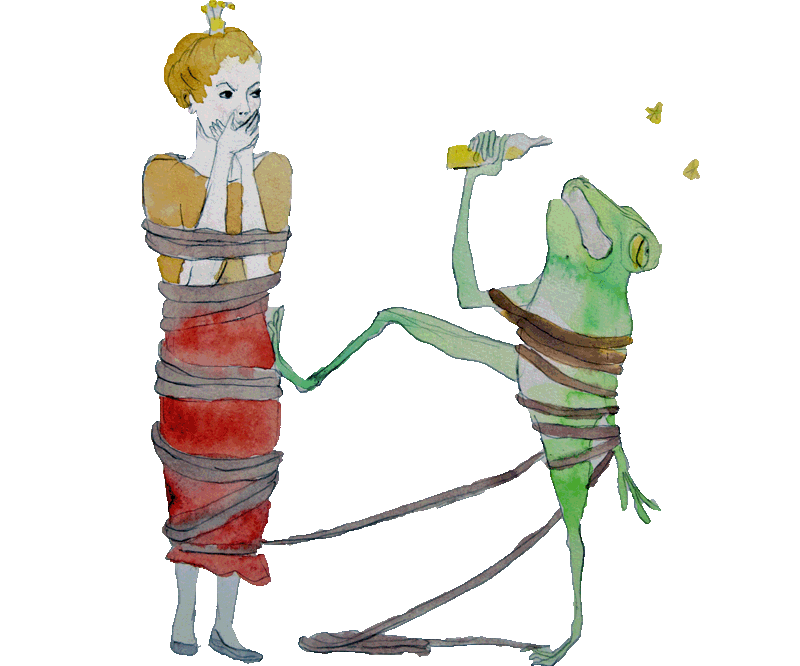
Nachstehend finden Sie ältere Meldungen aus den Vorjahren zum Thema der Angehörigen und meinem Engagement in der Sache.
2025-03 | Roman | Rezension
Kang, H. (2016). Die Vegetarierin. Berlin: Aufbau Verlage.
(Das Original erschien 2007 bei Ch'angbi, Seoul.)
Ich lese gerade zwei Autobiografien und ein Fachbuch zur Thematik der Angehörigen von Suchtkranken, hatte indes das Bedürfnis, eine Pause vom Thema zu machen und mal etwas anderes zu konsumieren. Meine Frau lieh mir das prämierte Buch Die Vegetarierin von der Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Erst im dritten Teil des Buches wurde mir klar, dass die Protagonistinnen Yong-Hye und ihre ältere Schwester In-Hye Kinder aus Suchtfamilien sind und prototypisch die Rollen vom Heldenkind ("hero") und verlorenen Kind ("lost child") nach Wegscheider-Cruse (1981) ausfüllen. Aber fangen wir vorne an und stellen erst die Geschichte vor. Um Sie nicht zu sehr zu spoilern, berücksichtige ich dabei nur den ersten von drei Teilen. Aus dem Eintrag des Romans bei Wikipedia:
Bevor sie zur Vegetarierin wurde, war Yong-Hye laut ihrem Ehemann eine unscheinbare und durchschnittliche Frau. Bis auf den Fakt, dass sie es verabscheute einen BH zu tragen, war an ihr nichts besonders. Dies ändert sich jedoch, als sie eines morgens beschließt, alle tierischen Produkte wegzuwerfen. Wenn sie nach dem Grund gefragt wird, warum sie sich auf einmal vegan ernährt, antwortet sie immer nur mit „Ich hatte einen Traum“. Für ihren Ehemann ist diese Veränderung absurd und unverständlich, er kritisiert Yong-Hye, unternimmt ansonsten jedoch nichts. Nach einem wichtigen Geschäftsessen mit seinen Vorgesetzten, bei welchem die Essensgewohnheiten seiner Frau auf weiteres Unverständnis trafen und ihre Anteilnahmslosigkeit am Geschehen die Stimmung senkte, beschließt er etwas gegen das Verhalten seiner Frau zu unternehmen.
Er ruft die Eltern und die Schwester von Yong-Hye an, welche von ihrer Veränderung geschockt sind, doch auch sie schaffen es nicht, seine Frau umzustimmen. Sein Verhalten gegenüber seiner Frau wird aggressiver, mehrmals vergewaltigt er sie sogar. Einen Monat später finden sich Yong-Hye und ihr Mann zu einem Familientreffen bei ihrer Schwester ein. Beim Essen ergreifen alle die Möglichkeit auf Yong-Hye einzureden und versuchen sie dazu zu bringen, wieder Fleisch zu konsumieren. Auf die umsorgenden Worte ihrer Schwester und die Versuche ihrer Mutter sie mit Fleisch zu füttern zeigt Yong-Hye jedoch keine Reaktion. Als sie auch auf den Versuch ihres Vaters nicht reagiert, wird dieser handgreiflich und schlägt sie. Er nimmt ein Stück Fleisch und steckt es seiner Tochter gewaltsam in den Mund, welche es sofort wieder ausspuckt, ein Obstmesser nimmt und sich die Pulsader aufschneidet.
Yong-Hye wird ins Krankenhaus eingeliefert. Während eines Besuches bemerkt ihr Ehemann, dass sie nicht im Bett ist und findet sie nackt im Hof des Krankenhauses auf einer Bank sitzen, mit blutverschmiertem Mund und einen blutbespritzten Vogel in der Hand haltend.
Der dritte Teil wird aus der Sicht der älteren Schwester In-Hye geschildert. Sie ist die einzige, die sich bis zuletzt um die psychisch kranke Yong-Hye kümmert. Erst aus den Erinnerungen an die Kindheit von In-Hye erfährt der Leser, dass der Vater der beiden ein gewalttätiger Alkoholiker ist, unter dem besonders die stille, sensible In-Hye gelitten hat. Die große Schwester hat sich schon damals um In-Hye gekümmert und sie nach ihren Kräften vor den Übergriffen des Vaters beschützt. Der Ehemann von Yong-Hye ist die Verkörperung von gefühlsloser, dissozialer Biederkeit und Spießigkeit. Es ist nicht verwunderlich, dass seine Durchschnittlichkeit, Hilflosigkeit und Verständnislosigkeit - wie beim Vater der Schwestern - in Gewalt umschlägt.
Die Brutalität von Vater und Ehemann, die familiäre Unfähigkeit, zu reden, das daraus resultierende empathielose, zwanghafte Bemühen, Normalität aufrechtzuhalten, hat im Roman mit der Institution der Psychiatrie eine gesellschaftliche Entsprechung. Die Psychiatrie des Romans ist eine totale Institution gemäß dem bekannten Soziologen Erving Goffman, die mit der Gewalt von Medikamenten, Freiheitsentzug, Fixierung und Zwangsernährung versucht - wie der Vater und Ehemann zuvor - Yong-Hye in die erwünschte Norm zu zwingen.
Yong-Hye hat mit ihrer Vulnerabilität, Stille, Empfindsamkeit, kindlichen Naivität und Beobachtungsgabe besondere Talente, die nie jemand, auch sie selbst nicht, erkennt, versteht oder fördert. Der Schwager kommt ihr zwar im zweiten Teil des Romans nahe, als er sie mit Blumen bemalt, verliert sich dann aber in seinen sexuellen Gelüsten, ohne der zärtlichen Bedürftigkeit von Yong-Hye gerecht zu werden. Von der blumigen Kunst des Schwagers inspiriert versucht Yong-Hye im dritten Teil durch die wahnhafte Vorstellung, kein Mensch oder Tier mehr, sondern ein Baum zu sein, der unerträglichen, blutigen Realität zu entkommen. Sie findet Trost und Frieden darin, eine unschuldige Pflanze zu sein, die nur Sonne und Wasser braucht. Ihre Schwester beginnt dies am Ende ein ganz wenig zu verstehen (S. 188):
Sie [In-Hye] sieht die Wahrheit klar und deutlich: Wenn nicht ihr Mann und Yong-Hye die Ersten gewesen wären, die Grenzen überschritten und damit ihre heile Welt zerstört hatten, dann wäre es wahrscheinlich sie selbst gewesen, die sich aufgelöst hätte und auf Nimmerwiedersehen verschwunden wäre. Hätte nicht das Blut, das ihre Schwester heute verloren hatte, aus ihrem eigenen Blut sprudeln müssen?
2025-03 | Fachbuch | Rezension
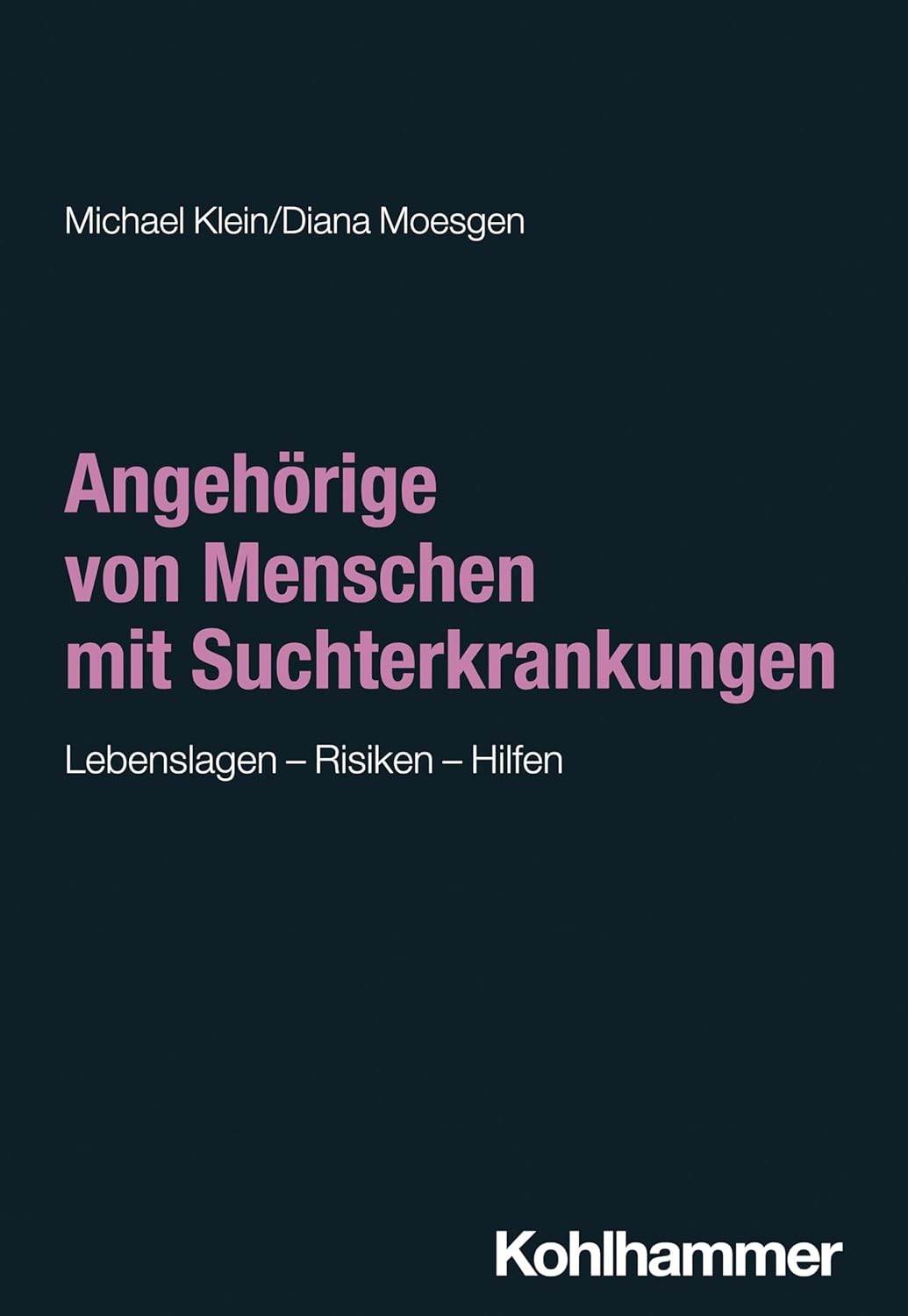
Klein, M. & Moesgen, D. (2025). Angehörige von Menschen mit Suchterkrankungen. Lebenslagen - Risiken - Hilfen. Stuttgart: Kohlhammer.
Das Socialnet ist eine Internet-Plattform, welche als "Portal, Community, Stellenbörse, Verlag, Webagentur, Contentspezialist" fungiert und "kostenlosen Zugang zu Fachinformationen für das Sozial- und Gesundheitswesen" bietet. Ich habe eine Rezension für das Sozialnet zur Neuerscheinung von Klein & Moesgen verfasst. Unter den Link unten können Sie sie aufrufen und lesen. Folgend mein Fazit zum Buch:
Die Neuerscheinung von Klein & Moesgen rückt eine vernachlässigte Gruppe in den Fokus: Kinder, Partner und Eltern von suchtkranken Menschen, um der Weiterentwicklung des Hilfesystems für diese Betroffenengruppen beizutragen. Die umfassende Darstellung der wissenschaftlichen Studien zu den vielschichtigen Belastungen und psychosozialen Auswirkungen auf die Angehörigengruppen ist einzigartig und überzeugend. Indes wird durch die Ausführungen zu den Erklärungsmodellen und Behandlungsansätzen die Komplexität und Schwere der dargestellten Problematik nur bedingt abgebildet.
2025-02 | Lesung | app:Bielefeld
Vom 16.-22. Februar 2025 fand die 16. bundesweiten Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien statt. Das Motto lautete: #ICHWERDELAUT. Dieses wie auch das diesjährige Plakat haben mir ausgesprochen gut gefallen. Die Woche startete am 13.02. mit einer Kick-Off-Pressekonferenz um 10 Uhr in Berlin. Auf der Konferenz ging es darum, ob die scheidende Bundesregierung ihre ausdrückliches Versprechen, Kinder aus Suchtfamilien mehr zu unterstützen, gehalten hat und was von einer neue Regierung diesbezüglich erwartet wird.
Ich bin sehr zufrieden damit, dieses Jahr den app:Bielefeld, das größte Netzwerk an Psychologischen PsychotherapeutInnen in Deutschland, als Kooperationspartner für eine Veranstaltung gewonnen zu haben. Am 19.02.2025 haben wir, eine Gruppe an AutorInnen und Betroffenen, in den Geschäftsräumen des app: eine Lesung durchgeührt. Aus dem Abstract zur Veranstaltung:
Vor allem Kinder, aber auch Partner und Eltern von uneinsichtig chronifizierten Suchtkranken leiden unter den Begleit- und Folgeerscheinungen von Sucht. Dauerstress, Unbeständigkeit, Manipulationen und Übergriffigkeiten prägen ihren Alltag. Als Folge entwickeln sie überdurchschnittlich häufig psychische Probleme und Störungen. Mehrheitlich sind es Frauen, die sich in helfenden Beziehungen zu Suchtkranken aufopfern und sich selbst und ihr Leben vernachlässigen. Die Folge sind Depressionen, Angststörungen, klassische und komplexe PTBS und psychosomatische Erkrankungen.
Es ist zu vermuten, dass eine beträchtliche Anzahl an KlientInnen in ambulanter Psychotherapie biografisch und/oder aktuell als Angehörige eines Suchtkranken belastet ist. Sucht ist immer noch ein Tabuthema, doch die Angehörigenproblematik ist doppelt tabuisiert. Viele Angehörige können ihre Betroffenheit angst- und schambedingt selbst im Schutzraum der Therapie nicht ansprechen.
Poesietherapie ist eine wunderbare Interventionsform. Sie kann unter anderem zur narrativen Exposition, zur Suche nach Lebenssinn oder zur Verbesserung der Selbstbeziehung eingesetzt werden. Geschichten zu erzählen, sprengt kreativ das Korsett der Sprachlosigkeit und Verleugnung und macht schlicht großes Vergnügen.
Wir sind Betroffene, AutorInnen und ein Psychotherapeut und wollen mit unseren Geschichten das tabuisierte Thema der Angehörigen aus dem kalten Schatten des Verschweigens ins warme Licht der Beachtung holen. Gemäß dem Schweizer Philosophen Peter Bieri ist es unser Anliegen, der verletzten Würde der Angehörigen mit erzählerischer Schwerkraft Raum und Stimme zu geben.
Die Lesung wurde als Fortbildung für Psychologische PsychotherapeutInnen durchgeführt. Bedauerlicherweise waren nur wenige KollegInnen gekommen und ich kann mir an dieser Stelle einen enttäuschten Seufzer über diese erstaunliche Abwehr unserer Berufsgruppe nicht verkneifen: Es hat eine lange psychotherapeutische Tradition, dass wir denken, dass das Thema (Co-)Abhängigkeit uns nicht oder kaum etwas anginge. Als Folge treffen in der ambulanten Psychotherapie symptomatische Sprachlosigkeit der KlientInnen auf professionelle Sprachlosigkeit der TherapeutInnen. Das ist nicht gut.
Die 25 ZuhörerInnen, die Ihren Weg in die Geschäftsstelle des app: gefunden haben, waren zur Hälfte KollegInnen und zur Hälfte Betroffene, nicht wenige waren beides. Die Lesung habe ich atmosphärisch dicht, fokussiert und berührend erlebt. Nach der Lesung hat sich eine offene und wertschätzende Diskussion zwischen allen Anwesenden entwickelt. Die Rückmeldung einer betroffenen KollegIn per E-Mail am Folgetag bringt es, wie ich finde, unprätentiös auf den Punkt:
... nach den Worten hatte ich gestern Abend gesucht: Diese Texte präsentiert zu bekommen macht die Sprachlosigkeit erfahrbar - und hilft vielleicht/hoffentlich, Verständnis dafür zu entwickeln und Patient:innen/Betroffene ernst zu nehmen und darin zu unterstützen, ihre Sprachlosigkeit zu überwinden.
Monika Trentowska vom Vorstand des app: hob hervor, dass die Texte eine alternative, geeignete Form wären, das innere Erleben der Betroffenen zu verstehen, aber weit darüber hinaus gingen. Der selbstbestimmte Akt, auf eine Bühne zu gehen und autobiografische Texte vorzutragen, verlasse den intimen, persönlichen Raum und auch den Schutzraum der Therapie Es bedeute, sich als Mensch sichtbar zu machen und Öffentlichkeit resp. Mitmenschlichkeit zu erzeugen. Sie griff auch den philosophischen Impuls von Frau Schickentanz auf, dass mittels des sprachlichen Ausdrucks die statischen Bilder, z.B. vom Leid der Betroffenen, anfangen würden, sich zu bewegen und lebendig zu werden. Ein anderer Zuhörer sprach diesbezüglich von "Ganzsein" und "Ganzwerdung". Schließlich würdigte eine suchttherapeutische Kollegin den Mut der Autorinnen, über die eigene Verletztheit öffentlich zu erzählen.
Mir hat es ausgesprochen gut gefallen, mein "Einzelkämpfertum" zu verlassen und mit anderen gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Solidarität überwindet Alleinsein. In diesem Sinne habe ich beobachtet, wie sich in der Pause und nach der Lesung Publikum und Vortragende vermischten - aus Vortragenden wurden Zuhörer und aus Zuhörern wurden Sprechende - und sich in vielen kleinen, wechselnden Grüppchen angeregt ausgetauscht wurde. Für die Zukunft ist eine zweite Lesung in einem größeren Rahmen für Bielefelder BürgerInnen angedacht. Auch sind schon Lesungen in Lüdenscheid und München terminiert und weitere in Planung. Ich möchte in Zukunft mehr auf dieses Format auf Augenhöhe setzen.
2025-01 | Neuerscheinung | Rezension
Schickentanz, A. (2025). Jenseits der Wand. Norderstedt: Book on Demand.
Vor beinah zwei Jahren hat mich die Autorin Annabelle Schickentanz gefragt, ob ich sie dabei begleite, einen autofiktionalen Roman über eine Kindheit in einer Suchtfamilie zu verfassen. (Hinweis: Autofiktionale Texte sind eine fiktionale Konstruktion autobiografischer Erfahrungen und dienen dazu, wahre persönliche Erfahrungen literarisch zu verarbeiten.) Am 02.02.2025 ist das fertige Werk im Self-Publishing erscheinen. Es war eine aufregende und lehrreiche Zeit, zweifelsohne für Frau Schickentanz, mithin auch für mich. Was habe ich gelernt? Daneben, dass ich noch mehr Verständnis und Tiefe für die tragische Situation, aber auch die Ressourcen von Kindern aus Suchtfamilien entwickeln konnte, möchte ich zwei Einsichten hervorheben: Ich habe von Frau Schickentanz gelernt, dass man Philosophie nicht vornehmlich mit dem Intellekt, vielmehr mit dem Herzen begreift. Und ich habe durch sie erfahren, wie tröstlich Philosophie sein kann, um das Leben und die Welt anzunehmen, auch wenn beides manchmal unerträglich, leidvoll und ungerecht erscheint.
Zur groben inhaltlichen Übersicht sei folgend der Buchrückseitentext aufgeführt:
Die Sucht der Mutter und materieller Wohlstand prägen Kindheit und Jugend der Erzählerin. Als die Mutter an den Folgen ihrer Sucht stirbt, begibt sich die Erzählerin auf die Suche. In der Rückschau spürt sie der Atmosphäre nach, in der sie aufgewachsen ist und wagt sich hinter der dissoziativen Wand von empfundener Ablehnung und Ohnmacht hervor. Sie beginnt, philosophische Fragen an ihr Leben zu stellen und enttarnt auf diese Weise allmählich das Zusammenwirken von Sucht, dem Schweigen der Anderen und der eigenen Scham.
Diesen Text möchte ich um eine Kostprobe aus dem Buch ergänzen, welche die persönliche Ambivalenz vieler Kinder aus Suchtfamilien auf den Punkt bringt. Die Protagonistin erklärt dort ihrer Freundin Ella (S. 181, 179):
Die empfundene Scham des Alkoholikers ist eine der Ursachen für die Sucht, ganz sicher ist sie eine Folge. Das Schweigen meiner Mutter, es war gleichgültig, beschämt und in der Folge beschämend. Meine Scham ist die Scham über eine Mutter, die getrunken hat. Die so viel und über einen so langen Zeitraum getrunken hat, dass sie daran gestorben ist. ... Meine Mutter hat mich mit meiner eigenen Scham zurückgelassen, sodass ich nun wählen kann, ob ich schweige oder spreche.
Was ist der besondere Wert des Werkes von Schickentanz, vor allem im Vergleich mit anderen Romanen zum Thema (siehe in der Rubrik Romane auf der Seite Medien)? Drei Antworten möchte ich Ihnen geben: Erstens spielt die Geschichte von Schickentanz im gut situierten Bildungsmilieu. Bekanntlich hat Sucht keine sozialen Schranken, sie kommt in allen Schichten vor. Dennoch ist es ein erstaunliches Phänomen, dass sich beinah alle anderen Autobiografien in Familien der Unterschicht abgespielt haben. Nach meinen klinischen Erfahrungen in der Arbeit sowohl mit Suchtkranken als auch Angehörigen ist die Tabuisierung, Maskierung und Verleugnung des süchtigen Problems in der Ober- und Mittelschicht deutlich ausgeprägter als in der Unterschicht.
Suchtbetroffenen und auch Angehörigen der Unterschicht fällt es tendenziell leichter, das Suchtproblem und die Begleit- und Folgeprobleme beim Namen zu nennen, z.B. zu sagen: "Mein Vater hat sich gestern wieder mal abgeschossen und rum randaliert. Es war voll ätzend, ich hätte kotzen können." Solche Sätze bringen gut erzogene Akademiker kaum über die Lippen. Sucht ist mittels des restringierten Codes oder des Straßejargons ungeschminkter, direkter auszudrücken. Dem Zierrat des elaborierten Codes wohnt eine diplomatische Tendenz inne, Dinge bis zur Konturlosigkeit weichzuzeichnen. Schickentanz ist hier eine erfrischende Ausnahme, sie findet trotz gehobener Sprache klare Worte zu dem süchtigen Tun ihrer Mutter. Und sie setzt ihre sprachliche Brillanz ein, um die familiäre und gesellschaftliche Doppelbödigkeit präzise zu sezieren und zu enttarnen. Ihr Mut zu dieser Offenheit und Authentizität ist zu würdigen.
Zweitens ist der Roman von Schickentanz nicht wie üblich chronologisch geordnet. Die Geschichte beginnt am Ende mit dem Tod der Mutter, erzählt dann Jugenderfahrungen der Protagonistin mit der Mutter und ihrer Familie, wird aber immer wieder durch Erinnerungen an Episoden der Kindheit, Reflexionen des Schreibprozesses, Assoziationen und Analysen unterbrochen und springt am Ende ins Erwachsenenalter. Der rote Faden von Jenseits der Wand ist die Entwicklung der Protagonistin bzw. der Schreibprozess der Autorin. Es ist insofern ein Entwicklungsroman. Auf dem Hintergrund einer äußerlich erstarrten Situation macht sich die Erzählerin auf den Weg, ihre innere Lebendigkeit zu erkunden. Der Leser darf daran teilhaben, wie sich die Autorin autofiktional auf eine Reise zu sich selbst macht, die Essenz der scheinbar unumstößlichen familiären Gewissheiten hinterfragt, Humor, Sinn und Würde in ihrer ganz eigenen Erfahrungswelt entdeckt und darüber sich der Welt und dem Leben öffnet.
Drittens darf das Buch als ein philosophischer Roman eingeordnet werden. Er ist voller metaphysischer, ethischer, soziologischer und psychologischer Reflexionen. Dies erinnert entfernt an die Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux. Die beiden Autorinnen verbindet das persönliche, familiäre Thema der Scham. Schickentanz nutzt unter anderem die Lehren von Martin Heidegger, Albert Camus, Peter Bieri, Ernst Bloch und anderen, um Schicht für Schicht die eigene, die familiäre und die gesellschaftliche Doppelbödigkeit freizulegen und sich von dem Ballast der intra- und interpsychischen Abhängigkeiten zu befreien.
Das Werk von Schickentanz ist vielschichtig, verstörend. Es ist zum einen in seinen Erzählungen anrührend, neugierig, trotzig, humorvoll, sinnlich und eigensinnig. Es lädt zu zwischenmenschlicher Nähe und Mitgefühl ein und löst Sympathie für die namenlose Protagonistin aus. Man kann gar nicht anders, als sie ins Herz schließen. Zum anderen ist der Text in seinen Reflexionen schonungslos, fordernd, kritisch und aufdeckend. Die Schreiberin schubst den Leser weg und hält ihm einen Spiegel seiner Verstricktheit und Verruchtheit vor. Das Buch kann nicht konsumiert werden, es widersetzt sich dem; es will entschlüsselt und durchdrungen werden. Dies löst Respekt, vielleicht sogar Ehrfurcht vor der Schreiberin und ihrer Authentizität aus. Einige Kapitel habe ich - aus einer inneren Notwendigkeit - zwei-, dreimal oder öfter gelesen, um alle Facetten zu verstehen. Die Tiefe der Erzählung und des Selbstfindungsprozesses kann durch den Leser nur erfahren werden, wenn er sich auf einen eigenen, ehrlichen, dialektischen Prozess einlässt. Schickentanz zu lesen, ist nicht leicht, doch lohnenswert, bereichernd und - wie schon oben angedeutet - tröstlich.
Und noch zwei letzte Zitate aus dem letzten Kapitel, welches die selbstannehmende, lebensbejahende und doch schmerzhafte Wahl und Motivation der Autorin, zu sprechen, verdeutlicht (S. 209 - 210, 211):
Die Antworten auf Ellas Fragen sind einfach und schwierig zugleich. Sie sind einfach, weil es Erklärungen gibt, Herleitungen, Einordnungen. Sie sind schwierig, weil die Antworten schmerzen, weil der Schmerz unsichtbar ist. An dieser Stelle droht meine Sprache zu versagen, da das Unsichtbare zwar potentiell sagbar ist, es jedoch für immer verborgen bleibt, sofern ich schweige. Noch perfider verhält es sich mit dem Sichtbaren - es umgibt mich, mitunter schon immer, jedoch ist es nicht automatisch sagbar. Damit es sagbar wird, braucht es jemanden, der die Wand öffnet, der dem Sichtbaren erlaubt, sich zu zeigen.
Wir sollten unser Leben vom Ende her denken, das Ende der Zukunft antizipieren, um das Zeitbewusstsein eines Kindes zu erlangen, das die Fähigkeit hat, sich dem Hier und Jetzt voll und ganz hinzugeben. Nach Kierkegaard ist es der Augenblick, welcher Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufhebt, der uns befreien kann von der Last des Gedankens an den Tod, an die unumstößliche Wahrheit, dass wir eines Tages gewesen sein werden. Bewegen sich unsere Ängste nicht auch in einem Raum, der aus der Vergangenheit gebildet ist und sehr mächtig in die Zukunft ragt? Demnach kann es helfen, das Gefühl der Erleichterung zu antizipieren, das immer dann eintritt, nachdem wir uns den eigenen Ängsten gestellt haben.

2024-12 | Vortrag & Lesung | Iserlohn
Am 02.12.2024 haben Frau Tessin von der Drobs Iserlohn und Frau Lichterfeld von der Angehörigenselbsthilfe zu einer Veranstaltung zum Angehörigenthema eingeladen. Wir wollten als Vortragende damit experimentieren, Vortrag und Lesung zu kombinieren. Aus dem Abstract zur Veranstaltung:
Die Millionen still leidenden Angehörigen von Suchtkranken fallen zwischen die Hilfenetze von Suchthilfe, Prävention, Psychotherapie und Gesundheitspolitik. Es fehlen bedarfsgerechte Angebote und die Systeme kooperieren ungenügend miteinander. So wiederholen die Betroffenen die familiäre Erfahrung, nicht gesehen, zurückgewiesen und alleingelassen zu werden.
Wir wollen uns in Vortrag und Lesung den Angehörigen solidarisch zuwenden und ihre Leiden und Probleme, aber auch ihre Ressourcen und Leistungen in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Jens Flassbeck wird fachlich zum Thema informieren und Annabelle Schickentanz wird die Fachinhalte durch Kapitel aus Ihrem autofiktionalen und noch unveröffentlichten Roman "Jenseits der Wand" emotional mit Leben füllen.
Die Veranstaltung richtete sich gleichermaßen an die Professionen der aufgezählten Hilfesysteme wie auch an Betroffene. Im Anschluss haben wir Raum für Ressonanz gegeben. Es ist immer wieder interessant, wie unterschiedlich die Nachgespräche ausfallen. Vor kurzem in München war das Publikum, welches überwiegend aus Betroffenen bestand, sehr lebendig beteiligt. In Iserlohn war das Feedback eher verhalten, die meisten ZuhörerInnen waren "satt" und wünschten, das Erfahrene sacken lassen. Schweigen ist auch eine gute Antwort. Ich bin mir sicher, dass auf dem Rückweg - mit dem notwendigen Abstand - Antworten entstanden sind.
Ich bin zwar erschöpft, doch mit guter Laune nach Hause zurückgekehrt. Gefreut hat mich unter anderem, dass KollegInnen gekommen waren, denn viele Betroffene gehen zu ambulanten PsychotherapeutInnen, um nach Hilfe zu suchen. Auch die Jugendhilfe war vertreten und hat die richtigen Fragen gestellt, z.B. wie die stillen Kinder in Suchtfamilien zu erkennen und erreichen sind (Dazu habe ich nachstehend eine Broschüre verlinkt). Unser Experiment, zu informieren und emotionalisieren, ist in meinen Augen gelungen. Als sonst eher Einzelkämpfer habe ich es genossen, gemeinsam auf der Bühne zu stehen.
Am meisten hat Frau Schickentanz und mich berührt, mit welcher herzlichen Zuwendung die Drobs Iserlohn das Angehörigenthema verfolgt. Das wünsche ich mir bundesweit.

2024-11 | Radio | Selbsthilfe
Einer Gruppenmoderatorin der Freundeskreise hat mich darauf hingewiesen: Sie und eine weitere Angehörige haben dem Radio Gütersloh ein Interview zur Thematik der Angehörigen und Selbsthilfe gegeben. Übrigens werde auch ich in dem Feature erwähnt. Aus der Ankündigung:
Selbsthilfegruppe für Angehörige von suchtkranken Menschen
Am 13. November 2024 ging es in unserer Sondersendung "Selbsthilfe hat Stimme" um ein Thema, das oft unter den Tisch fällt, aber unglaublich wichtig ist: Sucht trifft nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihre Familien. Angehörige leiden häufig unter großen emotionalen, psychischen und finanziellen Belastungen.
Wenn der Partner, ein Elternteil oder ein Kind abhängig ist – sei es von Alkohol, Medikamenten oder Drogen – trifft das auch die Angehörigen hart. Für sie ist es wichtig, Wege zu finden, wie sie mit der Situation umgehen können, ohne daran zu zerbrechen. Genau darum geht es in unserer Sondersendung am 13.11.2024. Wir stellen die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Suchterkrankungen in Gütersloh vor. Eva und Ulrike (Namen von der Redaktion geändert) erzählen ihre Geschichte – wie sie Hilfe fanden, schwierige Momente gemeistert haben, was die Treffen ausmacht und wie ihr selbst teilnehmen könnt.
Empfehlenswert, hören Sie selbst herein!

2024-11 | Musik
Eine Betroffene hat mich auf eine Neuveröffentlichung von Sarah Lesch hingewiesen. Auf der Platte "Gute Nachrichten" ist auch das Lied "Wenn er nicht trinkt". Lesch singt es aus der Perspektive einer Frau, welche mit einem Trinker liert ist. Der gleichermaßen ironische wie auch traurige Unterton, mit dem sie von dem gemeinsamen Lebensalltag erzählt, spricht mich sehr an. Die Frau steckt zwar noch in der Situation und man weiß nicht, ob sie sich befreien wird, doch sie hat schon verstanden, dass er nicht aufhören wird und sie dem ohnmächtig ausgeliefert ist.
Ich mag es gern, wenn er morgens schon auf ist
und mir liebevoll Kaffee ans Bett bringt,
weil er sowieso schon an der Theke war,
weil er nicht schlafen kann,
wenn er nicht trinkt.
...
Bei der Gelegenheit darf ich Sie auf die Seite Medien hinweisen. Dort finden Sie weitere Musik zum Angehörigenthema, aber auch Romane, Filme, Fotokunst etc. Alle Lieder und Platten dort habe ich gehört, alle Filme gesehen und alle Bücher gelesen, bevor ich sie auf die Liste aufgenommen habe. Diese kleine Bibliothek ist in den letzten vier bis fünf Jahren peu à peu entstanden. Das Auswahlkriterium für die Aufnahme auf die Seite ist, ob der Beitrag angehörigenzentriert ist. Falls Sie kreative Werke zum Thema kennen, die noch fehlen, schicken Sie mir gerne ein E-Mail.
2024-11 | Autobiografie | Rezension
Hoppe, C. (2024) Säuferkind. Mein Leben als Co-Abhängige und wie ich trotzdem glücklich wurde. Berlin: Ullstein.
Die letzten drei Jahre habe ich alle (autobiografischen) Romane zum Angehörigenthema gelesen, die mir empfohlen wurden und die ich finden konnte, insgesamt 20 Bücher. Jetzt reicht es! Auf meinem Nachttisch liegen schon zwei Bücher mit anderer Thematik. Darauf freue ich mich. Doch noch eine letzte Rezension zu einem Buch, dessen Wert darin liegt, dass es ganz unspektakulär und unprätentiös daherkommt. Cornelia Hoppe schildert ihre Geschichte als Säuferkind. Nachstehend die Inhaltsangabe von der Verlagsseite:
St. Pauli, 70er Jahre: Cornelia Hoppe wächst mit alkoholkranken Eltern in bitterer Armut auf. Ihr Spielplatz sind triste Trinkerkneipen mit zwielichtigen Gestalten. Einerseits schämt sich Cornelia schon als kleines Kind für ihre Eltern, andererseits sorgt und kümmert sie sich um sie – als typisch Co-Abhängige.
In der Ehe mit einem erfolgreichen Banker scheint sie dann schließlich das Glück gefunden zu haben. Leider merkt Cornelia aber irgendwann, dass auch ihr Mann trinkt und der Teufelskreis von vorne beginnt: Sie leidet still, schämt sich, kümmert sich, hält trotz allem zu ihm. Irgendwann erkennt sie, dass auch ihre Kinder drohen, co-abhängig zu werden. Trotz wirtschaftlicher Abhängigkeit schafft es Cornelia schließlich, ihren Mann zu verlassen – und damit sich und ihre Kinder zu retten.
Säuferkind ist ein ehrlicher, schonungsloser Bericht, der gleichzeitig Mut macht und zeigt, dass es möglich ist, sich aus den Fesseln der Co-Abhängigkeit zu befreien.
Wie auch das Buch von Klaffke-Römer, Mein Herz an stillen Tagen, könnte Hoppes Geschichte als Lehrbuch zu dem Themenkomplex Kinder aus Suchtfamilien und Co-Abhängigkeit genutzt werden. Ihre Autobiografie ist die einzige, die ich kenne, in der das Phänomen geschildert wird, wie die Kindheit in einer Suchtfamilie später in einer Ehe mit einem suchtkranken Mann mündet. Doch anders als Klaffke-Römer und andere schildert Hoppe ihre Geschichte ganz unaufgeregt. Sie nimmt die Perspektive einer Person ein, die erstaunt zurückblickt, was ihr alles widerfahren ist. So beherrscht Hoppe die Kunst, auch hochgradig beschämende Situationen nüchtern zu erzählen, ohne dass die Erzählung in "der Scham vor der Scham" versinkt. Ein Zitat dazu (S.194 - 195):
Die Reflexionen in dem Buch sind eher sparsam und klar, die Sprache ist einfach und der Erzählfaden stringent, ohne große Dramaturgie. Diese erzählerische Bescheidenheit wirkt stimmig, authentisch und sympathisch. Als Leser bin ich beim Lesen - mit Ausnahme des letzten Teils - nur milde affiziert worden, man fühlt mit der Protagonistin mit, ohne in ihrer leidvollen Betroffenheit zu versinken. Dadurch sind die Geschehnisse gut nachzuvollziehen, ohne eine schlaflose Nacht danach zu bewirken.
Es ist, als warte man auf ein Wunder. Man wünscht sich so sehr, dass es eintritt. Ich habe dann gedacht, so Mutti, heute ist alles schön, jetzt gehst du bitte nicht in die Kneipe. Die Folge war Enttäuschung.
Dass ich wiederum nicht die Ursache dafür bin, dass meine Eltern getrunken haben, das wusste ich schon. Und diese Erkenntnis ist gar nicht mal so wenig. Ich hatte keine Schuld auf mich geladen, war kein Kind, das seinen Eltern Kummer machte.
Die besondere Tragik einer Co-Abhängigkeit zeigt sich ja vor allem dadurch, dass man sich die Verantwortung für die Süchtigen selbst auflädt. Gleichzeitig wünscht man sich, dass das eigene Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Respekt und Liebe von den eigenen Eltern erfüllt wird. Die sind aber so sehr in ihrer eigenen Sucht gefangen, dass sie die seelischen Verletzungen, die ihre Kinder davontragen, nicht wahrnehmen.
Der letzte Teil (S. 203 ff.) hat mich doch noch emotional angefasst. Hoppe berichtet, wie sie mit einem Alkoholiker eine Beziehung beginnt, ihn heiratet und eine Familie gründet. Sehenden Auges rennt sie wieder in das Unglück, welches sie als junge Frau abgeschüttelt hat. Alles, was er tut - saufen, schimpfen, abwerten, beschämen, drohen, Gewalt etc. - kennt sie aus der Kindheit. Sie sieht alles, doch erkennt es nicht. Sie gerät immer tiefer in die co-abhängige Falle, obgleich Freundinnen sie warnen. Sie hört ihnen nicht zu.
Als Psychotherapeut (in der Position der Freundinnen) erfahre ich diese Ohnmacht mit Betroffenen jede Woche. Sie ist schwer auszuhalten. Ungezählte Klientinnen, Töchter aus Suchtfamilien, haben mir erst nach ein, zwei oder drei Jahren Therapie kleinlaut offenbart, dass ihr Partner auch suchtkrank ist. Noch mehr Klientinnen berichten in der Therapie hoffnungsfroh davon, einen neuen Mann kennen gelernt zu haben, bei dem "alles anders" sei, und hören nicht zu, wenn ich ihnen behutsam meine Zweifel mitteile, dass sie das Offensichtliche ausblenden. Dass Cornelia Hoppe dieses schwierige, schamhafte und schmerzvolle Phänomen schonungslos schildert, das ist der besondere Wert ihres Werkes. Noch ein abschließendes Zitat dazu (S. 226 - 227):
Wenn ich die Glaubenssätze meiner Kindheit suche, finde ich nichts, was mir in meiner Ehe hätte helfen können... Die Glaubenssätze, auf die ich zugreifen konnte, waren die einer Co-Abhängigen. Sie waren dazu geeignet, meine erneute Co-Abhängigkeit zu zementieren, und nicht, mir daraus zu helfen.
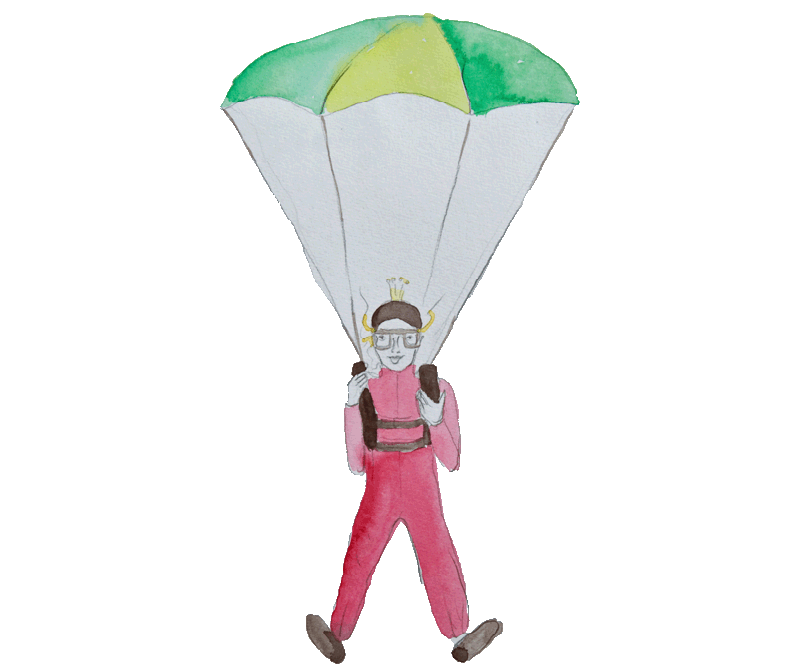
2024-11 | Versform
Die Mutter eines suchtbedingt verstorbenen Sohnes hat mir geschrieben, dass sie jedes Jahr zum internationalen Gedenktag für verstorbene drogengebrauchende Menschen am 21. Juli ein Gedicht schreibt. Zwei davon habe ich auf der Seite Versform mit ihrem Einverständnis aufgenommen. Nachstehend einige Strophen aus dem Gedicht: "Du bist gegangen". Die Worte vergegenwärtigen eindrucksvoll, dass selbst nach dem Tod und in der Trauer die dysfunktionale, suchtzentrierte Familiendynamik fortbesteht. Das vollständige Werk und viele andere finden Sie auf der Seite Versform unter der Rubrik Ansichten.
...
Du bist gegangen.
Es fehlt ein Teil;
nichts ist mehr heil.
Zählte für dich denn nur noch der Stoff
und deshalb tagtäglich zu Hause der Zoff,
Ärger, Geschrei, nur Streit und Zank!
Kaum auszuhalten, es machte uns krank.
Aber deinen Tod zu ertragen, das ist schwer,
ich habe keinen Bruder mehr.
Ihr – ihr trauert - als gab es ihn nur allein,
das tut mir weh, so kann es nicht sein!
Alles dreht sich nur um ihn, immer und immer;
Dieses zu spüren macht es noch schlimmer.
Selbst gegenwärtig - nach seinem Tod,
seht ihr mich nicht, nicht meine Not!
Trauer – Neid auf ihn, durchzieht mein Herz,
wer – frag ich mich – lindert meinen Schmerz?
Hallo Ihr -
ich bin noch hier!
...

2024-10 | Vortrag | München
Angestoßen durch ein Interview von mir in der Apotheken-Umschau hatten Herr Gerstlacher, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Blauen Kreuzes München, und ich vor einiger Zeit eine anregende Korrespondenz zum Angehörigenthema. Als Resultat davon hat er mich für den 21.10.2024 zu einem Vortrag nach München in der Paul-Gerhardt-Kirche in München-Laim eingeladen. Der Vortragstitel lautete: "Modelle Angehörige Sucht".
Das Blaue Kreuz München bietet Selbsthilfe sowohl für Suchtbetroffene als auch für Angehörige an. Sechs Angehörigengruppen habe ich auf der Website gezählt. Vorbildhaft! Zu dem Abend waren ungefähr 70 Personen gekommen, die Hälfte waren als Angehörige und die andere Hälfte durch Sucht betroffen. Bedauerlicherweise waren nur wenige KollegInnen anwesend. Auch um mit Ressentiments aufzuräumen, aber vor allem aus Gründen der Wertschätzung, habe ich 17 Fachkonzepte der Angehörigenproblematik vorgestellt. Danach habe ich mein Metakonzept vertieft, in das die vorgestellten Ansätze eingeflossen sind. Besonderes Augenmerk galt dabei der einseitigen Dynamik des abhängigen Systems. Abschließend habe ich mein Selbsthilfe-Konzept Leben zurück! angerissen.
Für mich als Vortragender und Psychotherapeut ist es stets spannend, was für eine Resonanz meine Worte auslösen. So viele intelligente Zwischenfragen und -bemerkungen von Angehörigen und auch Suchtbetroffenen habe ich noch nie erlebt. Besonders berührt hat mich das Feedback einer Angehörigen am Ende. Sie äußerte, mitzunehmen, dass sie sich Raum für sich selbst nehmen dürfe. Diese Möglichkeit erlebe sie als neu, seltsam, befremdend. Daraufhin habe ich sie gefragt, wie es sich anfühlt, dass sie sich gerade Raum nehme, sich anzusprechen. Sie konnte es noch nicht sagen, doch die keimende Freude und Trauer darüber konnte ich schon in ihrem Gesicht und ihren Augen erkennen. Für eine solche kleine Begegnung lohnt es sich, nach München zu fahren.
Ich bin mit einem zuversichtlichen, bestärkenden Eindruck nach Hause gefahren, dass Angehörige in München eine solidarische und kompetente Anlaufstelle haben. Eine gekürzte Version der Präsentation zum Vortrag habe ich Ihnen angehängt.
2024-10 | Autobiografie | Rezension
Aus dem Abstract zum Buch:
„Wessen Moral?“ ist ein autobiografischer Roman über eine junge Frau, die retrospektiv das Verhältnis zu ihrer suchtkranken Mutter beleuchtet und zu verstehen versucht. Zunächst noch mit den Augen eines Kindes beobachtet die Autorin wie ihre Mutter Stück für Stück an Stärke und Lebenswillen verliert. Mehr und mehr lässt sich die Mutter von ihren eigenen Süchten leiten, bis sie schließlich an ihnen zerbricht. Cécile Koch versuchte lange, sich ihre verstörende Welt mit kindlicher Fantasie zurechtzurücken. Als Außenseiterin in der Nachbarschaft und Schule erfindet sie sich Freunde und erschafft sich eine eigene Realität. Mit vierzehn Jahren reist sie sechs Wochen mit einem kleinen Wanderzirkus mit und bezahlt dafür mit dem einzigen, was sie hat - mit sich selbst. Nach ihrer unfreiwilligen Rückkehr bricht ihr der Boden unter den Füßen weg...
Mit einfachen, nüchternen Worten betrachtet die Autorin rückblickend ihr Leben ohne geborgene Kindheit und ihren Versuch, aus eigener Kraft erwachsen zu werden. Nicht die nachträgliche Betroffenheit steht im Vordergrund ihrer Schilderungen. Vielmehr geht es um den Mut und auch die Probleme, das eigene Leben anzunehmen und selbstbestimmt zu führen. Der Titel „Wessen Moral?“ steht stellvertretend für alle Fragen nach den Gründen und der Gerechtigkeit der Welt, welche Cécile Koch beschäftigen.
Als ich ungefähr in der Mitte des Buches von Cécile Koch angelangt war, habe ich mich an eine Fortbildung vor einigen Jahren erinnert. Eine Kollegin hatte mir zum Ende kritisch zurückgemeldet, dass sie meine Ausführungen übertrieben drastisch fände. Diese Bewertung hat mich damals gekränkt. Ich hatte die ganz schlimmen Sachen ausgelassen, um die KollegInnen nicht zu sehr zu verstören. Wenn ich vor Betroffenen referiere, dann spreche ich auch die schrecklichen Sachen an. Die Betroffenen fühlen sich dadurch, so melden sie es mir zurück, in ihren Leiden und Schmerzen gesehen. Sie fühlen sich gewürdigt, wenn jemand versucht, das Unsagbare zu sagen.
In Veranstaltungen für KollegInnen erfahre ich immer wieder, dass viele das Thema nicht wirklich durchdringen können, entweder weil sie wohlbehütet aufgewachsen sind und die gesellschaftlichen Abgründe nur theoretisch aus Büchern und Filmen kennen oder weil sie ihr eigenes traumatisches Thema noch abwehren. Und ich erkenne die wenigen, welche selbst betroffen sind und denen dies bewusst ist. Sie sind still, schweigen und verstehen. Sie nicken fast unsichtbar an den richtigen Stellen und in ihren Augen kann ich traurige Freude darüber erkennen, dass ich versuche, ihre Not in Worte zu kleiden.
Wessen Moral? ist nicht die allerschlimmste Autobiografie, Asche meiner Mutter, Platzspitzbaby oder Kinderwhore sind nach meinem Dafürhalten noch drastischer, so schlimm, dass sie auch für mich nicht mehr nachvollziehbar sind. Das macht die ganz schlimmen Bücher irgendwie abstrakt und lesbar. Doch solche Vergleiche sind pietätlos: schlimm, schlimmer, am schlimmsten, am allerschlimmsten. Die Leiden der jungen Cécile sind sehr schlimm, gerade noch nachvollziehbar, was es eher schlimmer macht.
Ihr Ekel, ihre Scham, ihre Wut, ihre Verzweiflung, sie gehen unter die Haut und lösten körperliche Dissonanzen in mir aus. Der Dreck ihrer Kindheit war fühlbar. Die Scham und der Selbsthass von Cécile verkrampften sich wie eine Faust in meinem Bauchraum, dass ich Pausen machen musste, um zu atmen und mich zu lockern. Und vor allem das Mitgefühl mit der Protagonistin haben mich wiederholt geflutet. Ich musste dann das Buch weglegen, musste mich bewegen, mir einen bewussten Sinnesreiz zuführen, um mich zurück in meine eher friedliche Realität zu holen. Im Nachhinein denke ich, dass die besagte Kollegin zu der abwehrenden Gruppe an KollegInnen gehört. Ich würde ihr gerne das Buch von Koch schenken. Es berührt tiefgehend.
Es ist zwar schmerzhaft, doch befreiend und bereichernd, sich mit den eigenen biografischen Belastungen und Traumata auseinanderzusetzen. Darüber legt das Werk von Koch Zeugnis ab. Es ist ein mutiges und notwendiges Buch, weil es verdeutlicht, unter welchen armen und brutalen Bedingungen Kinder in unserem reichen, demokratischen Kulturkreis aufwachsen. Als besonders wertvoll habe ich wahrgenommen, dass Koch herausarbeitet, wie der emotionale Missbrauch den Nährboden für auch sexuellen Missbrauch schafft. Viele meiner KlientInnen haben wie Cécile in der Jugend erotische Ausbeutung durch ältere Männer erfahren und einige wurden durch den alkoholisierten Partner zum nicht einvernehmlichen Sex genötigt. Emotionaler und sexueller Missbrauch sind schrecklich, sie sind Spielarten derselben beschämenden, dissozialen Erniedrigung. Dazu abschließend ein Zitat aus dem Buch (S.215):
Aufgrund der Erfahrungen, die ich in meinem Elternhaus gesammelt hatte, hatte ich keine klare Vorstellung davon, was 'normal' ist. Ich sehnte mich so sehr nach Liebe und Aufmerksamkeit und war wir ein verhungerter Dackel gewillt alles zu tun, um anerkannt und geliebt zu werden. Ich hatte keine gesunde Ressource, die mir ein Signal gibt, dass hier eine nicht zu überschreitende Grenze überschrtten wird, sondern hatte andauernd das Gefühl noch mehr geben zu müssen, um endlich zu bekommen, wonach ich mich sehnte. Die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit hat mich damals fast terrissen. Der Direktor des Zirkus hat dies bewusst zu seinen Gunsten genutzt und heute würde ich ganz klar sagen: es war Missbrauch.
2024-09 | Platzspitzbaby | Buch & Film
Seit drei, vier Jahren "fresse" ich mich durch die Literatur zum Thema der Kinder aus Suchtfamilien und sonstiger Angehöriger, sehe alle Filme, die ich finden kann, und rezensiere Bücher und Filme. Biografische Beiträge haben einen besonderen Tiefgang, sie bieten Lesevergnügen und Erkenntnisgewinn. Als letztes habe ich das Buch Platzspitzbaby gelesen und den durch das Buch inspirierten, gleichnamigen Film gesehen. Die Geschichte von Michelle Halbheer ist leidvoll und typisch für das Schicksal der stillen, vergessenen Kinder aus Suchtfamilien. Die Besprechungen zum Buch und Film können Sie auf der Seite Medien unter den entsprechenden Rubriken einsehen.
Es ist ein außergewöhnlich mutiges und intelligentes Buch und Halbheer erzählt ihre resiliente Geschichte, wie sie als Kind die Hölle überlebte und dem Schicksal der transgenerationalen Weitergabe aus eigener Kraft entkam. Die Autorin analysiert darüber hinaus tiefgründig das Versagen der Gesellschaft und ihrer Institutionen. Dazu ein Zitat aus dem Buch (S. 108):
Die Nachbarn, der Pfarrer, der Tankstellenshop-Besitzer, manche Eltern oder andere zufällige involvierte Menschen machten keine Anstalten, mich zu retten. Oder intervenierten sie bei der zuständigen Behörde, und diese blieb - entgegen dem gesetzlichen Auftrag - untätig? Dass auch unzählige Polizeieinsätze, bei denen die Beamten Zeugen der desolaten Zustände wurden, kein Eingreifen der Vormundschaftsbehörde bewirkten, die meine Befreiung hätten prüfen müssen, erstaunt mich heute nicht mehr. Jene, die über keine Lobby verfügen, sind leicht Opfer: Weil von der allfälligen Hilfeleistung niemand erfährt und das Nichtstun keinerlei negative Konsequenzen bewirkt.
» Verlagsseite Buches
» Website und Trailer Film
» Titelsong auf Youtube
2024-09 | NACOA | Berlin
Auch ich bin schon lange Mitglied in der Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien. Das Jubiläum wurde mit zwei Veranstaltungen am 20.09.2024 in der Villa Elisabeth in Berlin begangen. Vormittags wurde eine Fachtagung durchgeführt, in der es schwerpunktmäßig um die Problematik der erwachsenen Kinder ging.
Neben einem Vortrag von Dr. Reinhardt Mayer, der anhand der Entwicklung von NACOA Deutschland e.V. einen Überblick über 20 Jahre Arbeit mit und für Kinder aus suchtbelasteten Familien gab, ging es am Vormittag insbesondere um die Zielgruppe der Erwachsenen Kinder. Ich hatte die Ehre, mit einem Impulsvortrag zur Thematik beizutragen. Danach wurde vom Journalisten Andreas Schneider eine Podiumsdiskussion mit Dirk Bernsdorf, Christina Reich, Nina Roth und mir und unter Einbezug des Publikums über Hilfsbedarfe und bestehende Angebote moderiert.
Am Nachmittag fanden Workshops statt, in denen die zukünftige Ausrichtung der Interessenvertretung in den Bereichen Bildung, Medien, Politik, Wissenschaft und Selbsthilfe diskutiert wurde, um Ideen zu sammeln, Konzepte zu entwickeln, Forderungen aufzustellen etc. Gezeigt wurde darüber hinaus die mut- und resilienzorientierte Fotoausstellung: "Gesicht zeigen! Was erwachsene Kinder suchtkranker Eltern stark gemacht hat" von Hauke Dressler.
Am Abend feierte NACOA eine Jubiläumsgala. Die JournalistInnen Christina Rubarth und Stephan Kosch führten durch den Abend und interviewten Betroffene, darunter eine Poetry-Slammerin, einen TV-Moderator und einen Journalisten. Der musikalischen Rahmen wurde durch die Sängerin Miss Pirate und den Schirmherrn des Vereins, Max Mutzke, gestaltet, beides auch bekennende Kinder suchtbelasteter Eltern. Der Abend war gleichermaßen berührend, wie auch laut, lebendig und stimmungsvoll. Den Abschluss bildete die Würdigung des Engagements des gesamten NACOA-Teams in Berlin wie auch das der RegionalsprecherInnen der Bundesländer.
Feste feiern, kann NACOA, das kann ich bezeugen. Was habe ich sonst noch aus Berlin mitgenommen? Angesichts der geringen Mitgliedergröße und des "adolszenten" Alters des Vereins, hat NACOA schon eine bewegte, reichhaltige und erfolgreiche Geschichte. Die Vielfalt an Ideen, Wissen, Kompetenzen und Engagement in der Sache, der an dem Tag in der Villa Elisabeth zusammenkam, hat mich tief beeindruckt. Jetzt geht es darum, den Worten weitere Taten folgen zu lassen. Was mir noch aufgefallen ist: Es waren viele junge Menschen anwesend. Das lässt hoffen.
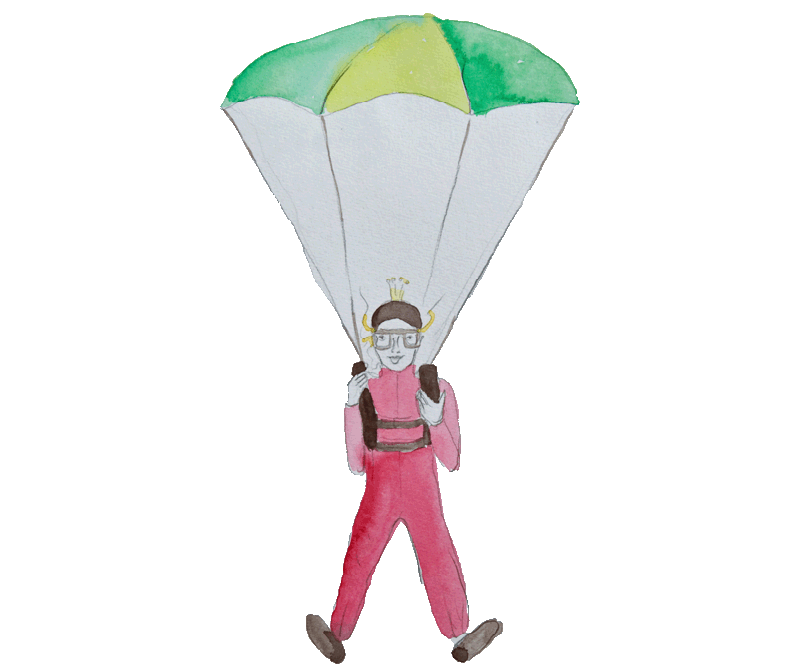
2024-09 | Versform
Heute sprach ich in der Therapie mit einem Klienten, erwachsener Sohn aus einer Suchtfamilie, darüber, wie wichtig Kreativität ist, um den Schmerz über das Erlittene auszudrücken, Alleinsein abzumildern und Verständnis und Trost zu finden. Dem inneren Unglück durch Singen, Tanzen, Malen, Dichten, Fotografieren etc. eine äußere Form geben, kann "schon fast wieder Glück" sein, wie der Dichter Erich Fried es in einem Gedicht ausgedrückt hat. Obendrein holt es den Ressourcenschatz aus dem Schatten des Verborgenen ans Tageslicht. Probieren Sie es selbst aus!
Und dann schickte mir heute eine andere Betroffene ein Gedicht, mit der Erlaubnis, es auf Co-ABHAENGIG.de zu veröffentlichen: "Der Freund - Jungenspiele spielen". Das Gedicht verdeutlicht, wie die Betroffene in Spieldrang, Selbstentdeckung und Welteroberung gehemmt worden ist. Sie drückt ihre schmerzhafte Sehnsucht danach aus, Alleinsein zu überwinden, sich zu befreien und sie selbst zu werden. Der Schreibprozess selbst ist auch und vor allem die heilsame Verwirklichung der verborgenen Ressourcen. Im Folgenden nur einige Strophen. Das vollständige Werk und viele andere finden Sie auf der Seite Versform unter der Rubrik Ansichten.
Der Freund
brettert mit mir Bälle gegen die blau-abblätternden Garagentüren
erzählt mir abenteuerliche Träume, wenn wir längst schon schlafen sollen
mopst eine Waffel aus dem Vorratsschrank, bevor wir wieder nach draußen verschwinden
holt mich aus meiner Barrikade zum Spielen
stromert mit mir zur Tonkuhle
wo wir noch nie waren
neckt mich mit seinen Kumpels
nimmt mich mit zum Baden im Kanal
zeigt mir, wie man ein Fahrrad ganzmacht
jagt mit mir Hühner
kann mit mir traurig sein
hat auch Angst
...
2024-09 | Roman | Rezension
»Mochte mein Vater auch manchmal unser letztes Geld in irgendeiner Spelunke versoffen, mochte er auch mehrmals meine Mutter blutig geprügelt haben: Ich wollte immer, dass er bleibt. Aber anders.«
Kaiserslautern in den neunziger Jahren: Christian Baron erzählt die Geschichte seiner Kindheit, seines prügelnden Vaters und seiner depressiven Mutter. Er beschreibt, was es bedeutet, in diesem reichen Land in Armut aufzuwachsen. Wie es sich anfühlt, als kleiner Junge männliche Gewalt zu erfahren. Was es heißt, als Jugendlicher zum Klassenflüchtling zu werden. Was von all den Erinnerungen bleibt. Und wie es ihm gelang, seinen eigenen Weg zu finden.
Mit großer erzählerischer Kraft und Intensität zeigt Christian Baron Menschen in sozialer Schieflage und Perspektivlosigkeit. Ihre Lebensrealität findet in der Politik, in den Medien und in der Literatur kaum Gehör. Ein Mann seiner Klasse erklärt nichts und offenbart doch so vieles von dem, was in unserer Gesellschaft im Argen liegt. Christian Baron zu lesen ist schockierend, bereichernd und wichtig.
Diese Inhaltsangabe auf der Verlagsseite macht nicht nur Werbung für das Buch, sie entspricht meiner Leseerfahrung. Das Buch ist in meinen Augen die deutsche, neuzeitliche Entsprechung zu dem irischen Klassiker Die Asche meiner Mutter von McCourt und dem amerikanischen Bestseller Ein Haus aus Glas von Walls. Diese beide Bücher und auch die Filme dazu werden Ihnen auf der Seite Medien vorgestellt. Baron wünsche ich, dass seine schmerzhafte und lehrreiche Geschichte ebenfalls verfilmt wird.
Ein Mann seiner Klasse ist ein durch und durch ambivalentes Werk. Die Diplom-Pädagogin und Fachbuchautorin Ursula Lambrou hat in Familienkrankheit Alkoholismus (1990) darüber geschrieben, dass viele betroffene Kinder in einem unerträglichen familiären Loyalitätskonflikt aufwachsen, den sie oftmals "lösen", in dem sie mit einer Seite paktieren und die andere ablehnen. Baron hält die Balance. Er pendelt zwischen Schwarz und Weiß geduldig erzählend hin und her, bis sein Roman Grautöne und Farben entwickelt.
Der Protagonist, der Junge Christian, ist zerrissen zwischen der Liebe und Bewunderung für den Vater einerseits und Angst, Hass und Ekel andererseits. Christian laviert zwischen den vielschichtigen, verfeindeten Familienfronten: Mutter gegen Vater, Vater gegen Tante, Tante gegen Tante, Mutter gegen Großvater. Diese Fronten sind durch süchtige, co-abhängige Gegensätze gekennzeichnet.
Schließlich muss Christian mit dem Erwachsenwerden zunehmend ein persönliches Gleichgewicht zwischen den gesellschaftlichen Klassen finden, dem "assozialen" Arbeitermilieu, aus dem er stammt, und dem "bürgerlichen" Bildungsmilieu, in das er aufgrund von Abitur und Studium hineinwächst. Ein hintergründiger, selbstreflexiver Humor hilf Christian, weder gleichgültig zu werden, noch Partei zu ergreifen und nach und nach eigene, unabhängige Sichtweisen zu entwickeln. Sympathisch ist das Buch darin, dass es ein offenes, unfertiges Ende hat. Christian ist am Schluss nicht geläutert, er kommt nicht zu einer allumfassenden Erkenntnis und es gibt kein Happy End. Das ist gut so. Lassen wir dem Autor das letzte Wort:
Mit all meinem Zorn und all meinem Glück, mit all meinem Schmerz und all meiner Überraschung, mit all meinem Scham und all meinem Stolz, mit all meiner Angst und all meiner Liebe, mit all meinem Hass und all meiner Hoffnung, mit all meinen Zweifeln werde ich kurz vor meinem Tod dieses eine Wort aussprechen, das mein Vater sein Leben lang nie von mir zu hören bekam: Papa.

2024-08 | NACOA | Online-Salon
NACOA Deutschland e.V. hat mit dem Online-Salon ein spannendes neues Format entwickelt. Aus der jüngsten Einladung dazu:
Der Salon bietet eine Plattform für Erwachsene Kinder, Interessierte, Fachkräfte und alle, die von einer suchtbelasteten Familie betroffen sind. Gemeinsam wollen wir uns zu ausgewählten Themen treffen, um uns über unsere Erfahrungen auszutauschen, Wünsche und Anregungen zu besprechen und offene Fragen zu beantworten.
Wir möchten besonders Fachkräfte dazu ermutigen, sich aktiv einzubringen, Fragen zu stellen und von den persönlichen Geschichten der Betroffenen zu lernen. Es ist uns wichtig, dass dieser Raum für alle Anliegen offen ist, egal ob sie sich direkt auf das Thema beziehen oder nicht. Zu Beginn werden wir 15 Minuten das Thema vorstellen, danach gibt es ausreichend Raum und Zeit, um alle Fragen, Wünsche und Anliegen zu besprechen.
Ihr Engagement und Ihre Offenheit sind entscheidend, um gemeinsam neue Impulse zu setzen und voneinander zu lernen. Alle, die von einer suchtbelasteten Familie betroffen sind – sei es als erwachsene Kinder, Interessierte oder Fachkräfte – sind herzlich willkommen.
Der nächste Termin am 4. September 2024 von 18.00 - 19.30 Uhr hat die Überschrift: Zwischen Stärken und Erschöpfung - Wie erwachsene Kinder aus suchtbelasteten Familien zwischen gesunder Anpassung und übermäßiger Leistung navigieren. Den Zoom-Link inklusive Meeting-ID und Kenncode finden Sie auf der verlinkten Seite für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien von NACOA.
2024-08 | Buch | Rezension
Thomas Lehr, der Protagonist der Geschichte und Schriftsteller, macht sich ungefähr 25 Jahre danach mit Schreibmaschine, Fotoapparaten und Schreibtischstuhl und ganz viel Augenzwinkern auf Spurensuche seiner suchtbelasteten Familiengeschichte. Eine Kostprobe dazu:
"Ich will während meines Urlaubs nicht zu Hause bleiben!", hatte Lehrs Frau erst neulich gesagt. "Ich will draußen etwas erleben!" Er erlebte drinnen etwas. In sich selbst. Da ging regelrecht die Post ab. Thomas Lehr brauchte das Draußen nicht. Er war gedanklich permanent unterwegs. Hauptsächlich in seiner Vergangenheit. Und in der Vergangenheit derjenigen Menschen, die damals um ihn waren. Man lebte ja nicht nur in seiner eigenen Vergangenheit. Andere Vergangenheiten wurden miterlebt. So griff Lehr mit dem Schreiben in die anderer ein. Ob sie es wollten oder nicht.
Es hat mir viel Vergnügen bereitet, den Protagonisten bei seinen Ausflügen im tiefsten, katholischen Sauerland auf der Suche nach seiner Geschichte und Identität zu begleiten. Der schon 52-jährige Lehr ist von seiner belasteten Kindheit in einer Familie, die nach außen den verlogenen heilen Schein der Bürgerlichkeit hochhielt, immer noch tief verunsichert. Seine Erinnerungen, Gedanken und Gefühle in Bezug auf sein vergangenes wie auch gegenwärtiges Leben sind entsprechend zögerlich und vage.
Dies findet Ausdruck darin, wie er durch die Wälder und Orte der Kindheit stolpert und irrt, z.B. auf der Suche nach einer Sprungschanze am Rimberg oder einem "schönen Ort" im Wald, den die Familie auf Ausflügen in den 60ern besucht hatte. Lehr findet zumeist nicht, was er sucht, dafür sieht er viele andere Dinge. Seine emotionale Unklarheit kontrastiert mit den genauen Beschreibungen z.B. von Familienereignissen, den Wäldern des Hochsauerlandes oder den technischen Details von Autos, die in der Familie kaputt gefahren wurden.
Das erinnert an die Bücher der Nobelpreisträgerin für Literatur, Annie Ernaux, die sich in einer Art Selbstfindungsprozess autobiografisch und soziologisch mit ihrer persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Entfremdung auseinandersetzt. Wie Ernaux untersucht der Protagonist nicht das Besondere, sondern das Profane, Alltägliche seiner kleinbürgerlichen Herkunft und Existenz. Und wie sie sucht er den Zugang zu sich im Außen seiner Erinnerungen - metaphorisch nennt er diese Dias - und obgleich er dort nicht fündig wird, geschieht dennoch eine innerliche Entwicklung und Klärung:
Wie es mir jetzt geht? Emotional fehlt mir die Brücke von der Kindheit zum Erwachsenenalter. Zur augenblicklichen Gegenwart. Scheinbar löst sich was. In mir. Scheinbar werden Gefühlselemente zurechtgerückt. Weiterhin bleiben Dinge unklar. Krankmachende Gefühle. Die kenne ich seit meiner Kindheit.
Wie viele Kinder aus Suchtfamilien hat Lehr Vernachlässigung und Gewalt erfahren und leidet als Folge an diffusen Ängsten, Identitäts- und Selbstwertproblemen. Der Autor, Christian Bedor, hat mit Thomas Lehr einen Antihelden gezeichnet, der eine sympathische Art hat, sich nicht zu ernst zu nehmen und mit seinen Unsicherheiten, Schwächen und Irrtümern tolerant, humorvoll und liebevoll umzugehen. Diese Resilienz, mit der ich mich als Leser gut identifizieren kann, ist der besondere Wert des Werkes von Bedor.
Kinder aus Suchtfamilien können gnadenlos kritisch mit sich sein. Wer also die herzerwärmende Resilienz von Lehr in sich entdecken möchte, dem ist das Buch wärmstens zu empfehlen. Übrigens kann man es trotz der sensiblen Inhalte abends gemütlich im Bett lesen und danach zufrieden einschlafen.
2024-06 | Spiegel | Interview
Vor kurzem hatte ich zwei Interviews zur Angehörigenthematik. Das bedeutet für mich stets viel Stress, neben der täglichen psychotherapeutischen Arbeit, mich den Fragen der JournalistInnen zu stellen und Rede und Antwort zu stehen. JournalistInnen wünschen möglichst spontane und prägnante Antworten. Als Psychotherapeut bin ich dies nicht geübt; ich bin gewohnt, anderen zu helfen, eigene Antworten zu finden. Auch ist es eine Gratwanderung, eine vielschichtige Thematik, wie es die Angehörigenproblematik der Sucht ist, verständlich auf den Punkt zu bringen, ohne zu vereinfachen.
Das Interview mit Ute Becker ist positiv verlaufen. Sie war ungewöhnlich gut vorbereitet, hatte schon zuvor zur Angehörigensache der Sucht veröffentlicht. Und sie hatte im Vorlauf ausgiebig mit drei Angehörigen gesprochen. Unser Gespräch war ganz spannend, weil wir beim Frage-Antwort-Spiel gemeinsam nach Antworten gesucht haben. Der Artikel von Frau Becker ist nun online auf Spiegel Psychologie erschienen und meines Erachtens vorzüglich geworden: Einfach, klar und fundiert. Nur ein kurzer Absatz aus dem Artikel, um keine Urheberrechte zu verletzen:
Hier erzählen drei Frauen von ihrer Kindheit mit suchtkranken Eltern und Großeltern – und von ihrer späteren Liebe zu suchtkranken Partnern und zu einer drogenabhängigen Tochter. Worunter haben sie gelitten? Welche Muster aus der Kindheit haben sich in späteren Partnerschaften wiederholt? Und vor allem: Was hat ihnen geholfen, sie zu durchbrechen?
Die Erzählungen der Betroffenen lassen das Thema konkret und lebendig werden. Unter den interviewten Frauen ist auch Jil Rieger, die ich aufgrund ihres kompetenten und authentischen Engagements für Angehörige sehr schätze. Bedauerlicherweise ist der Artikel nur mit Abo zu lesen. Dass sich große Medien wie der Spiegel dem Thema der Angehörigen Suchtkranker widmen, halte ich für bedeutsam, nicht nur um Betroffene zu erreichen und aufzuklären, sondern auch um Druck auf die Gesundheitspolitik auszuüben. - Mehr davon!
2024-06 | Buch | Rezension
Dieses literarische Debüt erzählt eine schmerzhafte Liebesgeschichte zwischen zwei unkonventionellen, freiheitsliebenden und sinnlichen Menschen. Die Frau, aus deren Perspektive geschrieben wird, ist erst achtzehn, als sie dem "Mann ihres Lebens" begegnet. Ihre Brüder sehen Ennos Hände und denken: Mit dem stimmt etwas nicht, doch wissen auch sie nicht, was. Das erste Jahr über gelingt es Enno zu verbergen, dass er alkoholkrank ist. Bald droht die Liebe ganz der Sorge und dem Mitleid zu weichen. Dagegen kämpft die Ich-Erzählerin an. Als Enno verunglückt, verschafft ihm das eine Pause. Monatelang trinkt er keinen Alkohol. Doch dann ...
Auf Co-ABHANGIG.de nehme ich ausschließlich angehörigenzentrierte Inhalte auf; das ist die Absicht, die Methode und der Sinn dieser Website. Wie auch schon beim Buch Dunkelblau (s.o.) verstoße ich mit der Berücksichtigung des Buches von Franziska Steinrauch - der Name ist ein Pseudonym, unter dem die Autorin Sonja Ruf veröffentlicht - eigentlich gegen die Maxime. Zwar ist der Roman aus der Perspektive von Franziska geschrieben, doch es geht fast ausschließlich um den alkoholkranken Ehemann Enno. Anders auch, als das zitierte Abstract es nahelegt, ist es eher eine konventionelle Trinkergeschichte, wie jemand persönliche und partnerschaftliche Freiheit und Sinnlichkeit im Suff ertränkt.
Der Verfall von Enno wird ungeschönt beschrieben, doch seine selbstsüchtige Zerstörungswut und seine destruktiven Motive werden einseitig verstanden und erklärt. Die Beweggründe, warum Franziska ihre Liebe über 20 Jahre mit Füßen treten lässt, bleiben im Dunkeln. Warum verlässt sie z.B. einen Liebhaber enttäuscht, mit dem sie sich eine feste Beziehung wünscht, weil sie in einem Detail unterschiedliche sexuelle Vorstellungen haben, bleibt aber bei Enno, obgleich er sie in allen Belangen enttäuscht? Selbst als er Abstinenz erzielt, dreht sich alles weiter um sein überwundenes Leiden und seine wiedergewonnene Lebendigkeit. Die Verzweiflung und das Leben von Franziska werden allenfalls angedeutet.
Anders als z.B. in der Erzählung von Sheff Beautiful boy, kriegt die Geschichte nicht die Kurve, Franziska in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Die Frau bleibt blass. Dies löst ein ambivalentes Empfinden in mir aus, ich finde es gleichermaßen konsequent als auch schade. Schade ist es, weil es wirklich irgendwie auch eine Liebesgeschichte ist und die Fragestellung spannend wäre, wie sich Franziska trotz der frustrierenden Partnerschaft ihre Liebesfähigkeit und Lebenszugewandtheit erhält.
Warum habe ich das Buch hier dennoch aufgenommen? Erstens gibt es Romane über eine Kindheit in einer Suchtfamilie häufiger, Romane über eine süchtig, co-abhängige Partnerschaft eher weniger. Zweitens legt das Buch zwischen den Zeilen und bis zur letzten Zeile Zeugnis darüber ab, was Co-Abhängigkeit ist: Das Kreisen um den Suchtkranken, selbst wenn dieser die Sucht an den Nagel hängt und ins Leben zurückkehrt. Die Überwindung der Sucht beendet nicht die Co-Abhängigkeit, ein häufiger Irrtum von verstrickten Angehörigen.
Drittens möchte ich einen persönlichen Wunsch äußern, der mit jeder Seite gewachsen ist, zum Ende des Werkes in der wiederholten Enttäuschung beinah schmerzhaft wurde, und mich damit direkt an die Autorin wenden: Frau Steinrauch, bitte, schreiben Sie einen zweiten Roman über die Geschichte von Franziska, über ihre Verzweiflung, Ängste, Träume, Hoffnungen und Enttäuschungen, ihren co-abhängigen "Affen", ihre Liebschaften, biografischen Prägungen, welche ihre Abhängigkeit, aber auch Liebe begründen, und Ihre Karriere als Schriftstellerin, über Ihre kleinen und großen Erfolge und Misserfolge als Ehefrau, als Liebhaberin, als Schriftstellerin und vor allem als (Mit-)Mensch. Bitte, trauen Sie sich, für Franziska!
2024-05 | Buch | Rezension
Die Literaturwissenschaftlerin Janina Hecht hat ihren Debütroman über eine scheinbar normale, kleinbürgerliche Kindheit in einer durchschnittlichen deutschen Familie geschrieben, doch das familiäre Miteinander und die Atmosphäre wird zunehmend durch die Alkohol- und Verhaltensexzesse des Vaters belastet. Das Abstract zum Buch:
Behutsam tastet sich Teresa an ihre Kindheit und Jugend heran, ihr Blick in die Vergangenheit ist vorsichtig geworden. Erst unsichere Versuche auf dem Fahrrad an der Seite des Vaters, lange Urlaubstage im Pool mit dem Bruder, Blumenkästen bepflanzen mit der Mutter in der heißen Sommersonne. Doch die unbeschwerten Momente werden immer wieder eingetrübt von Augenblicken der Zerrüttung, von Gefühlen der Hilflosigkeit und Angst. Da schwellt etwas Unausgesprochenes in dieser Familie - alle scheinen machtlos den Launen des Vaters ausgeliefert zu sein, Situationen beginnen gefährlich zu entgleisen. Ebenso unaufdringlich wie fesselnd erzählt Janina Hecht von schönen und schrecklichen Tagen, von Ausbruch und Befreiung und vom Versuch, sich im Erinnern dem eigenen Leben zu stellen. In diesem Sommer ist die bewegende Geschichte einer Familie auf der unentwegt gefährdeten Such nach einem stillen Glück.
Das gut zu lesende und kurzweilige Werk von Hecht mutet skizzenhaft an. Die Ich-Erzählerin versucht sich, zu erinnern, doch die Erinnerungen sind zunächst vage, anekdotisch und fragmentiert, geordnet allein durch die Chronologie der Ereignisse. Im Verlauf des Buches und mit dem Älterwerden von Teresa gewinnen sie an Zusammenhang und Sinn. Die Schilderungen der Episoden sind zwar aus der Perspektive von Teresa, doch der Leser erfährt nur andeutungsweise über ihr Innenleben. Diese Zurückhaltung bietet viel Spielraum für den Leser, innezuhalten und sich einzufühlen. Statt einer Rezension möchte ich drei Stellen aus dem Buch zitieren, um einen Eindruck zu geben (S. 25, 45, 159):
Wenn ich an diese Jahre denke, frage ich mich, ob es eine Kontinuität der Ereignisse gibt, eine Entwicklung, auf die ich mich verlassen kann. Ich versuche die Situationen zu ordnen, sie zusammenzuhalten, in ihnen etwas zu finden, was über die konkreten Momente hinausweist.
Diese Momente, in denen mir seine Spur verloren geht. Als wäre er auf einmal nicht mehr dabei gewesen. Dann steht er im Zentrum von allem und nichts kann ohne Bezug zu ihm sein.
Manchmal bin ich wütend darüber, dass ich nie wieder mit ihm sprechen kann. Aber diese Wut hat keine Richtung. Ich kann sie nicht herunterschlucken und sie verschwindet nur sehr langsam.
2024-04 | Freundeskreise NRW | Vortrag
Der Arbeitskreis Angehörige des Landesverbandes NRW der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe hatte mich zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion geladen. Die Veranstaltung fand am 17.04.2024 im IKK Gebäude in Gütersloh statt. Den Titel: "Angehörige sind auch betroffen", hatte ich bewusst trotzig gewählt. In der Ankündigung zu einer Fachtagung zum sozialen Umfeld von Sucht hatte ich gelesen, dass Angehörige mit-betroffen seien und mit-beachtet und mit-behandelt werden sollten. Das ist eine gesundheitspolitische Lesart, die bedauerlicherweise in der Suchthilfe weitverbreitet ist und durch welche die Angehörigenproblematik marginalisiert wird.
Dem habe ich im Vortrag entgegengehalten und konkret ausgeführt, dass Angehörige leidvoll betroffen sind, eine angehörigenzentrierte Beachtung verdienen und bedarfsgerechte, spezialisierte Angebote durch Selbsthilfe, Prävention, Beratung und Therapie benötigen. Aus der Ankündigung zur Veranstaltung:
Abhängigkeit ist ein soziales System. Kinder, Partner, Eltern oder Geschwister von Suchtkranken sind dauerhaft vielfältigem Stress sowie allzu häufig psychischen und physischen Übergriffigkeiten ausgesetzt. Sie vernachlässigen darüber ihre eigenen Aktivitäten, Interessen und sozialen Bezüge. Hinzu kommt, dass sie oftmals keine oder kaum Unterstützung erfahren, weil sie selbst und andere ihre Hilfebedürftigkeit nicht erkennen. Die Angehörigen bleiben in der schwierigen, ausweglosen Situation allein und können darüber psychosoziale Probleme und Störungen entwickeln. Angehörige fallen zwischen die Netze der Hilfesysteme. Ihre Problematik benötigt daher sehr viel mehr Beachtung, Engagement und Vernetzung durch Selbsthilfe, Suchthilfe, Jugendhilfe und Psychotherapie.
Der Abend war - wie stets bei dem tragischen Thema - sehr lebendig. Indes war es der pure Zufall, dass mich am nächsten Tag in der Sprechstunde eine Suchtberaterin anrief und das Gespräch damit eröffnete, dass sie meiner These zustimme, dass die Suchthilfe im Allgemeinen viel zu wenig für Angehörige tue. Auch in ihrer Einrichtung fehle es völlig an Angeboten für Angehörige, was sie als selbst Betroffene frustriere. So sehr ich zwar mit dem Abend und den Begegnungen und Diskussionen zufrieden war, bin ich doch mit einem ein wenig niedergeschlagenen Gefühl des Gescheitertseins verblieben, dass sich in den zweieinhalb Jahrzehnten, in denen ich mich mit dem Angehörigenthema beschäftige und mich als Fachbuchautor engagiere, gesundheitspolitisch wenig in der Sache verändert hat. Auch in meiner Region Ostwestfalen-Lippe kann ich, abgesehen von der lobenswerten, doch begrenzten Initiative einzelner KollegInnen oder Einrichtungen, keine nachhaltigen, strukturellen Fortschritte erkennen.
Eine Schieflage ist mir schon bei der Vorbereitung des Vortrags klar geworden: Suchtverbände, Selbsthilfevereine und auch Einrichtungen der Suchthilfe sind Lobbyvertretungen der Suchtkranken. Das ist ihr Zweck und dies ist im Prinzip gut so. Wenn sich diese Vertretungen allerdings den Angehörigen zuwenden, geraten sie in einen Interessenkonflikt; das liegt in der "Natur der Sache". Es ist ein wenig so, als wenn sich Männergesangsvereine in Fragen der Emanzipation der Frauen einmischen. Das muss schiefgehen. Wir haben eine starke Lobby für Suchtkranke, doch die Lobby für Angehörige ist deutlich unterrepräsentiert. Das ist nicht gut.
Früher wollte ich die Suchthilfe reformieren, heute bin ich bescheidener geworden und freue mich schon über kleine regionale oder individuelle Entwicklungen. An dem Abend habe ich eine Reihe engagierter Mitglieder der Freundeskreise kennengelernt. Ich habe erfahren, dass in Bielefeld und Minden neue Selbsthilfegruppen gegründet worden sind und eine Gruppe in Gütersloh quicklebendig ist, welche ich vor einigen Jahren initiiert habe. Und ich habe ehemalige und aktuelle Klientinnen aus Gütersloh getroffen, denen es auch als Folge ihrer Therapie gutgeht. Vielleicht am meisten hat mich die Rückmeldung eines schon älteren, erwachsenen Sohnes aus einer Suchtfamilie berührt, der sich seit Jahren in der Selbsthilfe engagiert, dass er durch die Inhalte dazu gelernt habe, dass seine Betroffenheit noch viel tiefer gehe, als ihm bisher klar gewesen sei. Der Arbeitskreis Angehörige der Freundeskreise und ich haben schon angedacht, im nächsten Jahr einen weiteren Abend zu gestalten.
2024-05 | Buch | Rezension
Das Original erschien 2016 unter dem Titel Into the Magic Shop. Das Buch von Doty ist schwer zu kategorisieren. Es ist sowohl ein autobiografischer Roman über eine Kindheit in einer Suchtfamilie als auch ein Betroffenenbuch, ein Mutmachbuch und ein Ratgeber über die Resilienz, Unglück in Glück zu verwandeln. Auf der Seite Literatur habe ich es in der Rubrik Betroffenenliteratur berücksichtigt.
Doty erzählt von seiner Kindheit mit einem suchtkranken Vater und einer depressiv, suizidalen Mutter, welche durch Vernachlässigung, Verwahrlosung, Streit und Gewalt geprägt ist und wie er sein vorbestimmtes Schicksal überwindet und ein weltberühmter Neurochirurg wird. Im Mittelpunkt des ersten Teils steht eine kurze Episode mit 12 Jahren, als er zufällig in einem Laden für Magie auf die geheimnisvolle Großmutter Ruth trifft. Er beschreibt, wie er die Sommerferien mit ihr im Magierladen ihres Sohnes verbringt und sie ihn vier Lehren des Lebens lehrt:
Körper entspannen, Stress- und Krisenmodus herunterfahren (Sympathikus) und entspannte Haltung einnehmen (Parasympathikus)
Gedankenkontrolle, distanzieren von den Stimmen im Kopf
Herz öffnen und Schmerz akzeptieren und verstehen, Mitgefühl und Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber
Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühle, Lebensziele setzen und verfolgen
Doty sieht zwar Ruth nie wieder, doch verwirklicht er im Folgenden erfolgreich seine Träume gemäß ihrer Magie. Im zweiten und dritten Teil des Buches schildert er, wie er Arzt und Neurochirurg wird und die dritte Magie, also die Geheimnisse des Herzens entdeckt. - Mehr sei hier nicht verraten, um Sie nicht zu spoilern.
Doty hat eine typische, herzergreifende Geschichte des amerikanischen Traums publiziert, die allerdings nie kitschig wird, weil er ehrlich und unprätentiös die Irrungen und Wirrungen seines Lebensweges beschreibt. Mich hat das Buch auch ergriffen, weil Ruths Magie im Prinzip mit dem Behandlungskonzept von mir und Barth ("Die langen Schatten der Sucht", 2020) übereinstimmt.
2024-04 | NACOA | Fotoausstellung
Der Fotograf Hauke Dressler und der Journalist Stephan Kosch haben die Fotowanderausstellung Gesicht zeigen! erstellt. Das Projekt wurde durch die KKH Kaufmännsche Krankenkasse gefördert. Im Fokus von Fotos und Texten steht die Resilienz von erwachsenen Kinder aus Suchtfamilien. Aus der Beschreibung der Ausstellung von der Website von NACOA Deutschland:
Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen zehn unterschiedliche erwachsene Menschen, darunter eine junge Tänzerin, ein Priester, ein stolzer weiblicher Fußballfan, eine FASD-Betroffene, ein prominenter Sänger, ein diverser TV-Moderator. Dazu weitere Männer und Frauen unterschiedlichen Alters. Sie teilen eine gemeinsame Erfahrung: eine Kindheit im Schatten der elterlichen Sucht. Das bedeutet in vielen Fällen Vernachlässigung, Überforderung, Übergriffe, manchmal auch Gewalt. Für Kinder aus suchtbelasteten Familien geht es ständig um Leben und Tod. Doch diese zehn Menschen haben nicht nur überlebt, sondern sind zu beeindruckenden Persönlichkeiten geworden. Was hat sie stark gemacht?
Dieser Frage geht die Ausstellung auf 24 Roll-Ups nach und zeigt die unterschiedlichen Antworten: Tanz, Musik und Malerei als Möglichkeit, Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken; die biographische Arbeit als reflektierender Rückblick in das eigene Leben; Religion und Spiritualität als Kraftquelle; eine tragende Gemeinschaft im Sport oder in einer der wenigen Gruppen für betroffene Kinder und Jugendliche; die Geborgenheit einer Ersatzfamilie; die Liebe zu sich selbst.
Die Ausstellung kann gegen eine Schutzgebühr ausgeliehen werden.

2024-02 | COA-Aktionswoche | Lesung mit Musik
Vom 18. bis 24.02.2024 findet in Deutschland und anderen Ländern die alljährliche Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien statt. Von der Website der COA-Aktionswoche:
Kinder aus suchtbelasteten Familien sollen gehört und gesehen werden. Mit der COA-Aktionswoche rücken wir Kinder aus suchtbelasteten Familien eine Woche lang in den Fokus der Öffentlichkeit und der Medien, damit deutlich wird: Mehr als 2,6 Millionen Kinder in Deutschland leiden unter Suchtproblemen ihrer Eltern. Wir, das ist zum einen der Verein NACOA Deutschland, der die COA-Aktionswoche bundesweit organisiert – aber natürlich auch alle Mitmachenden, wie Vereine, Initiativen, Organisationen, Anlaufpunkte, COA-Hilfsangebote, Selbsthilfegruppen u. v. m.
Während der COA-Aktionswoche – immer im Februar:
sensibilisieren wir Menschen, die mit Kindern arbeiten (Erzieher*innen, Lehrer*innen, Sporttrainer*innen, Jugendgruppenleiter*innen, Ärzt*innen etc.), Kinder aus suchtbelasteten Familien zu erkennen.
stellen Projekte und Initiativen mit Aktionen und Veranstaltungen ihre Arbeit vor.
machen wir Hilfsangebote öffentlich.
fordern wir politisch Verantwortliche von Gemeinden bis in den Bund auf, sich für mehr Unterstützungsangebote für COAs einzusetzen und diese Hilfen langfristig zu finanzieren.
Die COA-Aktionswoche gibt es seit 2011 in Deutschland und in den USA. Außerdem findet sie z.B. regelmäßig auch in Großbritannien, der Schweiz, in Korea oder Slowenien statt.
Wir haben uns als Kooperationbündnis an der Aktionswoche beteiligt: die Fachstelle Sucht des Diakonischen Werkes Herford, die Psychotherapiepraxis J. Flassbeck und die 2023 neu gegründete Selbsthilfegruppe, "LEBEN! lernen", für eKS in Bielefeld. Am Freitagabend, 23.02., haben wir im "Lutherhaus" in Herford eine Lesung mit Musik veranstaltet. Der große Saal wurde federführend von Anja Schoop von der Fachstelle Sucht festlich geschmückt und war von gewiss 40 Altarkerzen in mildes Licht getaucht. Das Event wurde von drei Betroffenen aus der Selbsthilfegruppe anmoderiert.
Annabelle Schickentanz las fünf Kapitel aus ihrem philosophischen, autofiktionalen Roman Jenseits der Wand über eine Kindheit in einer Suchtfamilie vor. Die Texte erzählten vom vielschichtigen Erleben einer Betroffenen hinter der dissoziativen Wand von Beschämung, Ohnmacht und Sprachlosigkeit. Die Schilderungen waren angereichert durch metaphysische Überlegungen zu den destruktiven Mechanismen der familiären Verstrickungen und trösteten mit hintergründigem Verständnis und auch Humor. Die Musikerin Lisa Türk improvisierte in den Kapitelpausen zu den Texten am Schlagzeug. Ihre rhythmische Umsetzung z.B. der allgegenwärtigen, alles betäubenden Schamgefühle der Protagonistin des Romans gingen unter die Haut. Dazu eine Kostprobe aus dem Manuskript:
Die empfundene Scham des Alkoholikers ist eine der Ursachen für die Sucht, ganz sicher ist sie eine Folge. Das Schweigen meiner Mutter, es war gleichgültig, beschämt und in der Folge beschämend. Meine Scham ist die Scham über eine Mutter, die getrunken hat. Die so viel und über einen so langen Zeitraum getrunken hat, dass sie daran gestorben ist. Meine Mutter hat mich mit meiner eigenen Scham zurückgelassen, sodass ich nun wählen kann, ob ich schweige oder spreche.
Da das Manuskript noch im Werden befindlich und unveröffentlicht ist, wohnte das Publikum einer echten Premiere bei. In Anbetracht der experimentellen Situation - Frau Schickentanz hatte noch nie zuvor öffentlich vorgelesen, Frau Türk kannte die Texte nicht -, war ich als Veranstalter über die Qualität, den Tiefgang und die Souveränität des künstlerischen Zusammenspiels beeindruckt. In der Pause und nach der Veranstaltung habe ich Meinungen aus dem Publikum gesammelt, in denen mein positiver Eindruck voll und ganz bestätigt wurde. Ich wünsche, dass die beiden weitere gemeinsame Auftritte haben, und freue mich auf den Tag, wenn ich das gedruckte Buch von Schickentanz in der Hand halte, es in Gänze lesen und für Sie hier auf Co-ABHAENGIG.de rezensieren darf.
Zu den Veranstaltern: Die Fachstelle Sucht des Diakonischen Werkes Herford bietet Beratung für betroffene Kinder und erwachsene Angehörige an und ist nach FitKids zertifiziert. Als Psychotherapeut biete ich schwerpunktmäßig Psychotherapie für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien und andere betroffene Angehörige nach Flassbeck & Barth (2020) an. Zwischen der Herforder Angehörigenberatung und mir besteht seit langem eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Sache. In der Selbsthilfegruppe "LEBEN! lernen" treffen sich erwachsene Kinder aus Suchtfamilien, welche in unserer Praxis in Therapie sind oder waren, um ihr traumatisches Alleinsein zu überwinden und sich gegenseitig zu unterstützen, das eigene Leben unabhängig zu gestalten.
2024-02 | Rezension | Schloss aus Glass
Das Buch von Walls wurde auch verfilmt. In der folgenden Rezension konzentriere ich mich auf das Buch. Eine zusätzliche Einschätzung zum Film finden Sie auf der Seite Medien in der Rubrik Spielfilme. Zum biografischen Hintergrund von Film und Buch auf Wikipedia:
Der Film basiert auf dem autobiografischen Roman Schloss aus Glas (Originaltitel The Glass Castle: A Memoir) von Jeannette Walls aus dem Jahr 2005, ... Walls beschreibt in Schloss aus Glas ihre schwere Kindheit und wie ihre Eltern mit vier Kindern durch die USA vagabundierten. In den ersten fünf Jahren ihrer Ehe hatten ihre Eltern 27 Adressen, da ihr Vater es an keinem Arbeitsplatz länger aushielt und kein Geld für die Miete hatte. Zudem fühlte sich der alkoholkranke und wahrscheinlich bipolare Rex vom FBI verfolgt. Rose Mary, ihre Mutter, war wahrscheinlich auch bipolar und hielt sich für eine Künstlerin.
Die Kinder mussten oft hungern, in zerschlissener Kleidung herumlaufen und wurden daher in den verschiedenen Schulen, die sie besuchten, von ihren Mitschülern gehänselt. Als die Familie in den Heimatort des Vaters Welch in den Appalachen zurückkehrte, lebten sie bei Verwandten in einem Haus mit drei Zimmern ohne Wasser, Strom und Heizung, wo es feucht und schmutzig war und von Ungeziefer, Schlangen und Ratten wimmelte. Da Jeannette dies nicht mehr aushielt, schlug sie sich im Alter von 17 Jahren bis nach New York durch, wo sie in der Bronx bei ihrer älteren Schwester Lori wohnte. Dort machte sie ihren Schulabschluss, lieh sich von allen möglichen Leuten Geld und arbeitete in einer Anwaltskanzlei, um sich das Studium auf dem New Yorker Barnard College zu finanzieren.
Die Geschichte von Schloss aus Glas gewinnt ihre Dramatik aus der vielschichtigen Ambivalenz einer Suchtfamilie. Die amerikanische Journalistin Jeanette Walls erzählt die Ereignisse ihrer Kindheit, ohne sittliche Maßstäbe anzulegen. Sie beschreibt - typisch Journalistin - aus einer eher äußeren Perspektive, ohne zu verurteilen oder zu idealisieren. Dem Leser hilft diese nüchterne Erzählweise, Abstand zu wahren und sich weder mit der Liebe, den Abenteuern und der Faszination des Vagabunden-Lebens der Walls noch mit den Entbehrungen, Erniedrigungen und Leiden der Kinder allzu sehr zu identifizieren.
Mal schlägt das Pendel in die eine Richtung aus: "Reiche Stadtmenschen hatten schicke Wohnungen, aber ihre Luft war so verschmutzt, dass sie die Sterne nicht einmal sehen konnten, und wir wären ja schön verrückt, wenn wir mit ihnen tauschen wollten", mal in die andere Richtung: "Und mit erhobener Stimme fügte ich hinzu: »Ich hatte Hunger.« Mom starrte mich erschrocken an. Ich hatte gegen eine unserer stillschweigenden Regeln verstoßen: Es wurde von uns erwartet, dass wir stets so taten, als wäre unser Leben ein einziges langes, unglaublich lustiges Abenteuer."
Walls schafft es bis zum Ende, diese Ambivalenz feinfühlig auszubalancieren. Dieser Herangehensweise ist geschuldet, dass sie selten eine Innenperspektive des kindlichen Erlebens einnimmt. Der Hunger, der Ekel und die Schmerzen der Protagonistin Jeanette werden zwar benannt, doch werden sie mit wenigen Ausnahmen nicht näher ausgeführt, anders als z.B. in dem autobiografischen Roman Shuggie Bain. Diese sachliche Erlebensverzerrung ist typisch für traumatisierte Kinder aus Suchtfamilien, es ist eine funktionale Überlebensstrategie. Walls bleibt als Lieblingstochter so gegenüber Vater und Mutter loyal, sie schützt sich und ihre Familie vor moralischer Vereinnahmung durch andere und ihre Geschichte ist dadurch zugänglicher, lesbarer als die von Shuggie Bain.
Bei letzterer Autobiografie zersetzen die Auswirkungen des Suchtmittelkonsums die Familienbande und Shuggie, wie auch die älteren Geschwister zuvor, befreit sich, indem er weggeht. Bei Schloss aus Glass wird der Familienzusammenhalt hingegen durch die suchtbedingten Katastrophen noch gestärkt und die Protagonistin findet zu sich, indem sie in den Schoß der Familie zurückkehrt und zu dieser und der gemeinsamen Geschichte steht.
Obendrein nimmt Walls durch ihre Nüchternheit den mannigfaltigen Traumata den Schrecken, überfordert die LeserInnen nicht emotional und macht das Thema der Suchtfamilie einem breiterem Publikum zugänglich. Schloss aus Glass konnte so ein Bestseller werden. Zwar haben der Vater und die Mutter auf fast schon sympathische Art und Weise darin versagt, ihre grandiosen beruflichen, künstlerischen und gesellschaftlichen Ansprüche und Versprechungen zu verwirklichen, doch die Tochter macht es besser und gibt der familiären Geschichte eine unverhoffte, erfolgreiche Wendung. Sie versilbert, so kann man es metaphorisch sagen, das Scheitern des Vaters, Gold zu finden.
Im Film wirft die erwachsene Jeanette dem Vater am Ende vor: "Reden ist nicht gleich Handeln." Die Autorin Jeanette Walls scheint diesen tragischen Zwiespalt ihrer Eltern im und durch das Schreiben überwunden zu haben. Es ist eine resiliente Geschichte.

2024-01 | Sonntagszeitung FAZ | Artikel
Vor einigen Wochen hatte ich ein Interview mit der Journalistin Alexandra Dehe von der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zur Angehörigenproblematik der Sucht. Schon im Interview war ich positiv überrascht, dass Frau Dehe die in meinen Augen richtigen Fragen stellt. Ihr Artikel unter dem Titel Hör auf! ist am 14.01.2024 veröffentlicht worden. Die appellhafte Überschrift ist doppeldeutig, weil er sich gleichermaßen auf das dysfunktionale, abhängige Handeln von Suchtkranken und Angehörigen bezieht.
Von der Qualität des Artikels bin ich sehr angetan. Anhand von zwei typischen Fällen durchdringt Frau Dehe die partnerschaftlichen Auswirkungen der Sucht, die Probleme und Not der Angehörigen sowie das tragische Aufeinanderbezogensein von Sucht und Co-Abhängigkeit. In der Kürze des Textes bringt sie die Betroffenheit und den Unterstützungsbedarf der Angehörigen auf den Punkt. Eine Kostprobe aus dem lesenswerten Text:
Er glaubte, als Ehemann versagt zu haben. Obwohl seine Frau keine Rückfälle hatte, ging es ihm noch schlechter als in den Jahren zuvor. Hinzu kamen Symptome wie Schlaflosigkeit, ständige Schweißausbrüche und Panikattacken. „Da wusste ich, dass es so nicht weiterging, und habe eine Therapie angefangen“, sagt Thomas. Bis dahin dachte er, sich Hilfe zu suchen sei Ausdruck von Schwäche – heute ist er davon überzeugt, dass es ein Zeichen von Stärke ist.
Bedauerlicherweise benötigen Sie ein ABO der FAZ, um den Artikel zu lesen. Falls Sie dennoch hineinschauen wollen: Ein dreiwöchiges Probe-ABO ist kostenfrei. Doch vergessen Sie nicht, es zu kündigen!

2024-01 | Memorandum DHS | Stellungnahme
Mein Anspruch für Co-ABHAENGIG.de ist, möglichst positive, angehörigenzentrierte Inhalte zu liefern. Doch das Anliegen ist auch, kritisch aufzuklären. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) hat im letzten Newsletter (5.2023) informiert, ihr Memorandum Angehörige in der Suchtselbsthilfe nach zehn Jahren erneuert zu haben. Der selbsterklärte Anspruch ist es, die Diskussion anzuregen.
Der Text ist meines Erachtens weder erneuert noch liefert er diskussionswürdige, angehörigenzentrierte Erkenntnisse. In dem Memorandum schafft es die DHS, nahezu die gesamte Literatur, fast alle fundierten Modelle und Konzepte und die vollständige empirische Datenlage auszublenden. Dies überrascht vor allem vor dem Hintergrund, dass die Materialien der DHS in Bezug auf Suchtmittel, Suchtkonsum und Abhängigkeitserkrankungen stets auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand sind.
Eigentlich wollte ich mich zu dieser defizitären "Leistung" nicht äußern, weil kein Ansatzpunkt da ist, konstruktiv Kritik zu üben. Doch dann hat es mir trotzdem in den Fingern gejuckt und ich habe eine Stellungnahme geschrieben. Mein Motiv dabei war weniger, Kritik zu üben, als vielmehr einen Kontrapunkt zu setzen und genau das tun, was die DHS nicht tut, nämlich die Literatur, die Konzepte, die Empirie und vor allem die AutorInnen, die sich in der Angehörigensache verdient gemacht haben, zu benennen und so zu würdigen. Aber bitte lesen und urteilen Sie selbst!
Und es hat sich gelohnt, ich habe etwas verstanden. In Bezug auf die Sache der Sucht und die Sache der Angehörigen gibt es einen Interessenkonflikt. Die DHS ist eine Lobbyvertretung für Suchtgefährdete und -kranke, was sich im Tendenziösen des Memorandum ausdrückt. Es ist, wie wenn sich ein Männergesangsverein in der Sache der Frauenrechte einsetzen würde. Mein Fazit: Wir brauchen viel mehr unabhängige Vereine, die sich solidarisch für Angehörige engagieren.
Die Stellungnahme habe ich der DHS zugesendet.
» Stellungnahme Flassbeck
» Memorandum DHS
Nachtrag 09/2024: Die DHS hat bislang nicht geantwortet.
2023-12 | Weiße Weihnacht
Als Psychotherapeut ist die Zeit um Weihnachten stets schwierig. Bei KlientInnen, die aus kaputten Elternhäuser kommen, z.B. weil die Eltern tranken, kommen die Erinnerungen an eine unglückliche Vergangenheit hoch. Und für KlientInnen, die mitten drin stecken, weil eine nahestehende Person suchtkrank ist, ist die Zeit emotional vergiftet, weil sie den widerlichen Auswirkungen der Sucht ausgesetzt sind und weil sie mit ihrer Sehnsucht konfrontiert sind, wie schön die Festtage sein könnten, wenn die Sucht nicht wäre.
Schauen Sie sich bitte die Weihnachtsgeschichte an! Es ist eine Erzählung, in der Not, Leid und Freude vorkommen. In diesem Sinne bedeutet Feiern, sich zu besinnen und sich sowohl über Wunder Leben zu freuen als auch über das Leid, welches Leben mit sich bringt, zu trauern. Die Kerzen, die wir im Dunkeln anzünden, symbolisieren beides. Feiern ist, zu staunen, zu lachen und auch zu weinen.
"Alle Kinder haben ein Recht auf Weiße Weihnacht." Unter diesem Motto nehme ich seit Jahren an der Kampagne Weiße Weihnacht teil und verzichte in trauriger Solidarität mit den Kindern aus Suchtfamilien über die Feiertage auf Alkohol. Unberauscht singt es sich viel schöner am Weihnachtsbaum. Und weil das Feiern mit nüchternem Kopf mehr Spaß macht, dehne ich die Aktion ebenfalls auf Silvester aus. Ein heißer Kinderpunsch zum Jahreswechsel schmeckt und wärmt wunderbar und das Feuerwerk kann man mit nüchternen Augen viel klarer genießen.
Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Advent, schöne Festtage und einen gelingen Jahreswechsel!
Hinweis: Das Bild zu diesem Artikel stammt von Stefanie Moshammer, einer Schweizer Künstlerin. Sie hat zum Thema Alkoholismus von Frauen, die gesellschaftlichen Stereotype von Suchtmittel und Frau, aber auch zu der familiären Betroffenheit eine Ausstellung gemacht: "Each Poison a Pillow". Auf der Website der Künstlerin können Sie Fotos dazu einsehen.
2023-12 | Roman | Rezension
Zur Geschichte aus der Zusammenfassung auf der Website des Verlags:
Tildas Tage sind strikt durchgetaktet: studieren, an der Supermarktkasse sitzen, sich um ihre kleine Schwester Ida kümmern – und an schlechten Tagen auch um die Mutter. Zu dritt wohnen sie im traurigsten Haus der Fröhlichstraße in einer Kleinstadt, die Tilda hasst. Ihre Freunde sind längst weg, leben in Amsterdam oder Berlin, nur Tilda ist geblieben. Denn irgendjemand muss für Ida da sein, Geld verdienen, die Verantwortung tragen. Nennenswerte Väter gibt es keine, die Mutter ist alkoholabhängig. Eines Tages aber geraten die Dinge in Bewegung: Tilda bekommt eine Promotion in Berlin in Aussicht gestellt, und es blitzt eine Zukunft auf, die Freiheit verspricht. Und Viktor taucht auf, der große Bruder von Ivan, mit dem Tilda früher befreundet war. Viktor, der – genau wie sie – immer 22 Bahnen schwimmt. Doch als Tilda schon beinahe glaubt, es könnte alles gut werden, gerät die Situation zu Hause vollends außer Kontrolle.
Nach ca. ein Drittel des Buches wollte ich nicht mehr weiter lesen. Es war mir alles zu schön, um wahr zu sein. Die Protagonisten der Geschichte sind mir zu intelligent, zu mutig und zu lebenserfahren, es entspricht nicht ihrem Alter. Trotz der widrigen Umstände machen sie stets alles richtig und sagen immer das Richtige. Das war mir zu glatt und es fehlte mir der Tiefgang, wie ihn andere Romane zum Thema haben, z.B. "Shuggie Bain" oder "Streulicht". Dann hat mich das Buch doch noch gefesselt. Warum?
Tilda und Ina repräsentieren die resiliente Gruppe an Kindern aus Suchtfamilien (40%), die unbeschadet ins Leben gehen. Tilda und Ina sind Modelle dafür, wie man den widrigen Verhältnissen einer Suchtfamilie trotzen kann, was man sagen kann, wenn die suchtkranke Mutter lügt und manipuliert, und wie man sich trotz allem treu bleiben, Unabhängigkeit wahren und den eigenen Weg gehen kann. Und die Liebesgeschichte zwischen Tilda und Viktor ist eine Blaupause dafür, wie zwischenmenschliche Annäherung, Vertrauen und Liebe möglich sind, ohne die eigene Unabhängigkeit aufzugeben.
"22 Bahnen" ist ein eher leichtes, trotziges und fast schon fröhliches Buch. Caroline Wahl schafft es, eine heitere und tröstende Geschichte über die Unbilden des Daseins zu erzählen, ohne kitschig zu werden. Für mich als Psychotherapeut liegt der besondere Wert des Werkes in seinem resilienten Charakter. Deswegen werde ich es in der Therapie nutzen und es Betroffenen empfehlen. Ich möchte mit einem wunderbaren Zitat aus dem Buch von S. 105 und 106 schließen, welches mir aus der Seele spricht:
Die Gewissheit, dass ich vieles verlieren kann, einen Vater, eine Mutter, eine normale Kindheit, dass nichts sicher und beständig ist, dass aber Bücher trotz allem bleiben, dass mir niemand diese Geschichten, diese Welten wegnehmen kann, in die ich zu flüchten vermag, beruhigt mich und macht mich unverwundbar.
2023-11 | Musik | Album
Ein erwachsenes Kind aus einer Suchtfamilie hat mir das Album "Outside Child" von Allison Russell empfohlen. Und weil man es nicht trefflicher formulieren kann, zitiere ich den Eintrag zum Album auf Wikipedia:
Outside Child is the debut album by Canadian singer-songwriter, poet, activist and multi-instrumentalist Allison Russell. Produced by Dan Knobler and released by Fantasy Records on May 21, 2021, it is Russell's first release as a solo artist following two decades of performing and releasing music as a member of the groups Po' Girl, Birds of Chicago and Our Native Daughters. Lyrically, the album details Russell's experiences with the abuse she endured as a child at the hands of her stepfather, with The New York Times describing it as “a harrowing story of survivor's joy” and Russell herself stating that “the record itself isn't really about abuse. It's about the journey out of that, and breaking those cycles. It is about resilience, survival, transcendence, the redemptive power of art, community, connection, and chosen family”.

2023-10 | Co-ABHAENGIG.de | Neue Seite
Im September habe ich einen Workshop gegeben. Eingeladen hatte mich der Bundesverband der Elternkreise suchtgefährdeter und suchtkranker Söhne & Töchter e.V. (BVEK). Der eintägige Workshop fand im Rahmen der Herbsttagung des BVEK statt, welcher dieses Jahr das 50. Jubiläum feierte. Der Titel lautete: "Gefangen in Verantwortung und Hilflosigkeit - lebenslänglich?"" Es waren über 80 Eltern aus ganz Deutschland gekommen, die überwiegend bewährte ModeratorInnen von Elternkreisen waren. Wir hatten einen lebendigen Tag und ich bin beeindruckt von der Offenheit, Erfahrung und Kompetenz der TeilnehmerInnen nach Hause gefahren.
Vier Wochen später habe ich noch einen eintägigen Workshop gegeben, diesmal veranstaltet von der Baden-Württembergischen Landesvereinigung der ElternSelbsthilfe Suchtgefährdeter und Suchtkranker e.V. Dieser Workshop war zwar etwas kleiner, doch intensiv und ebenso lehrreich. Bereichert von den vielfältigen Begegnungen und Einsichten, habe ich für Co-ABHAENGIG.de eine neue Seite entwickelt und programmiert: Raus aus der Falle. Es werden neun co-abhängige Fallen bzw. Schemata dargestellt und Anregungen gegeben, diese abzumildern. Aber schauen Sie bitte selbst!
» Neue Seite Raus aus der Falle
» Bundesverband Elternkreise
» ElternSelbsthilfe Baden-Württemberg
2023-10 | Film | Rezension
Ich komme gerade aus dem Kino: "Fallende Blätter" von Aki Kaurismäki. Es ist ein typischer, eigenwilliger Film des finnischen Regisseurs. Jede Szene ist wie ein Gemälde. Die Dramaturgie der Bilder wird u.a. durch den Kontrast gespeist, dass die Geschichte zwar in die heutige Zeit eingebettet ist, doch mit Requesiten der 60er und 70er Jahre ausgestattet ist. Und es wird wenig gesprochen. Vor vielen Jahren hatte ich eine Finnin in Therapie. Sie saß kaum, als sie mir lakonisch mitteilte, wie sehr es sie nerve, dass Deutsche so viel sprechen und sich für alles rechtfertigen müssen. Wir haben oft geschwiegen, was mir gefallen hat.
In diesem Sinne will ich kein überflüssiges Wort über Fallende Blätter verlieren. Nur so viel: Es geht um eine tragikkomische Liebesgeschichte zwischen zwei proletarischen Verlieren. Die nicht mehr junge Frau ist Kind aus einer Suchtfamilie. Der Vater starb durch Alkohol, die Mutter vor Kummer. Der ebenso nicht mehr junge Mann ist ein Trinker, der nichts mehr vom Leben erwartet.
Der Film ist eine pragmatische, nicht humorlose Blaupause, wie Klarheit und Nüchternheit hilft, Unabhängigkeit zu wahren und Liebe zu ermöglichen. Beide Protagonisten sind zwar wortkarg, doch keinesfalls sprachlos. Der ruhige Erzählstrom von Kaurismäki erlaubt es dem Zuschauer, sich bevormundungsfrei eigene Gedanken über das Gesehene zu machen und den eigenen Stimmungen nachzugehen. - Eine kleine Geschichte und großes europäisches Kino!
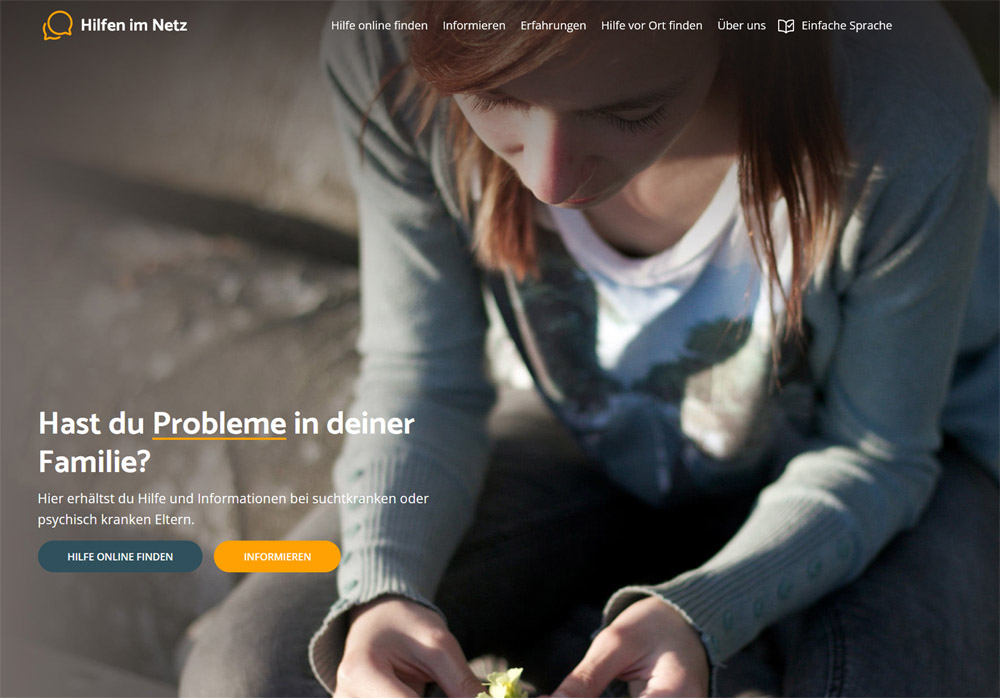
2023-10 | Neue Website | Hilfen im Netz
Es gibt eine neue Online-Plattform namens Hilfen im Netz für Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener suchtkranker und psychisch kranker Eltern. Die Website ist durch die Drogenhilfe Köln e.V. in Kooperation mit NACOA Deutschland erstellt worden und führt die Online-Beratung von KidKit und NACOA zusammen. Die Zusammenführung ist ein Schritt des geplanten Ausbaus und der zugesagten Förderung von Angeboten für die Zielgruppe durch das Bundesgesundheits- und Bundesfamilienministerium.
2023-09 | ARWED | Ratgeber
Die Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger Menschen e.V. in NRW (ARWED) hat ein Buch herausgebracht. Von der Website:
Ehemalige Süchtige und von Sucht betroffene Eltern und Angehörige haben ihr Erfahrungswissen in einem "Erfahrungsweitergeber" zusammengestellt. Wir haben die Erfahrungen und Perspektiven der Betroffenen gegenüber gestellt und in verschiedenen Phasen dargestellt. Um die schwierige Situation für beide Seiten zu bewältigen, braucht es Reflexion, Empathie und emotionale Intelligenz.
Was mir an dem Buch sehr gut gefällt, ist, dass sowohl der Prozess der Betroffenen, zu lernen, mit ihrer Suchterkrankung klarzukommen, als auch der Prozess der Eltern, zu lernen, mit ihren suchterkrankten Töchtern und Söhnen klarzukommen, parallel dargestellt werden. Auf den linken Seiten des Buches stehen die Erfahrungen der Eltern und auf der rechten Seite die der suchtbetroffenen erwachsenen Kinder. Das ist spannend und lehrreich gemacht.
2023-09 | Drobs Iserlohn | Vortrag
Die Drobs Iserlohn hat ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Als Referent hat man mich unter folgendem Titel eingeladen: "Co-abhängige Systeme und ihre soziale Tragik". Diese Themenwahl der Drobs finde ich mutig. Doch eine etablierte und selbstbewusste Suchthilfe darf sich ruhig ein wenig Selbstkritik leisten, ohne sich die Feierlaune zu verderben. Das Thema ist darüber hinaus ein notwendiges. Sich in die Probleme der suchtkranken Klientel zu verstricken, ist das Berufsrisiko der MitarbeiterInnen und der Institutionen der Suchthilfe. Darüber gemeinsam zu reflektieren, bedeutet Psychohygiene zu betreiben.
So erstaunt, wie ich über die Einladung war, genauso positiv überrascht war ich über das Wohlwollen und die Selbstverständlichkeit, mit der die KollegInnen der Drobs dem Angehörigenthema begegneten. Dies kenne ich eigentlich nur aus Rheinland-Pfalz. Ich hatte viel Vergnügen an dem kollegialen Austausch und durfte mich darüber freuen, dass in der Drobs alles vorhanden ist, was Standard in der Angehörigenarbeit ist: Einzelberatung, Gruppe und Selbsthilfe für Angehörige.
Zu den Inhalten meines Vortrags: Begonnen habe ich mit den tragischen Ressentiments der deutschen Suchtpolitik, z.B. der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (Memorandum "Angehörige in der Sucht-Selbsthilfe", 2013), das Co-Abhängigkeitskonzept als stigmatisierend und schädlich abzuwerten und die Leiden und Probleme der Angehörigen als Stress zu bagatellisieren. Diese Vorurteile fußen auf zwei theoretischen Veröffentlichungen (Puhm & Uhl, 2007; Klein & Bischof, 2013), in denen - wunderlicherweise - beinah die gesamte Literatur zum Thema nicht berücksichtigt wurde. Die missachteten Konzepte durfte ich in Iserlohn dem Publikum würdigend vorstellen:
Persönlichkeitsstörung (Cermag)
Familienstörung (Wegscheider-Cruse, Lambrou)
Copingverhalten (Wegscheider-Cruse, Black, Rennert, Lambrou, Barnowski-Geiser)
Schemastörung (Black)
Transgenerationale Weitergabe (Black)
Bindungs- und Beziehungsstörung (Woititz)
Emotionsregulationsstörung (Woititz)
Verhaltensbezogene Abhängigkeitsstörung (Schaef)
Institutionelle Störung (Schaef)
Genderspezifische Beziehungs- und Selbstwertstörung (Beattie)
Komplexe Traumafolgestörung (Mellody)
Gesellschaftliche Störung (Arenz-Greiving)
Stress (Velleman, Templeton et al.)
Ressourcen (Lambrou, Barnowski-Geiser)
Die näheren Angaben finden Sie unter Literatur. Der Widerspruch, die aufgelisteten Konzepte gleichermaßen zu missachten als auch pauschal zu verurteilen, ist in meinen Augen destruktiv. Tatsächlich sind alle Konzepte in Sozialarbeit, Psychologie und Soziologie zeitgemäß und hilfreich. Ein komplexes Phänomen benötigt vielschichtige Erklärungsmodelle. Die Konzepte sind alle in mein eklektisches Modell von Co-Abhängigkeit (» Betroffenheit) und in meine Konzepte der Selbsthilfe und Beratung für Angehörige (Flassbeck, 2023) und die Verhaltenstherapie des komplexen Suchttraumas eingeflossen (Flassbeck & Barth, 2020).
Die zentrale co-abhängige Tragik sozialer Systeme, z.B. der deutschen Suchtpolitik und Suchtforschung, ist die übermäßige Fixierung auf die suchtkranken Symptomträger und die Bagatellisierung der Leiden und des Hilfebedarfs der Angehörigen. Um dieser Tragik abzumildern, möchte ich alternativ eine ganzheitliche Sichtweise und Vorgehensweise in Bezug auf das (co-)abhängige System vorschlagen. Professionelle Helfer können Teil des Systems werden. Von Iserlohn bin ich mit guter Laune nach Hause gefahren. Die regionalen Initiativen und Leuchtturmprojekte sind es, die zuversichtlich machen, dass ein Wandel von unten möglich ist.
2023-08 | Neuveröffentlichung | Rezension
Eine Kollegin aus der Suchthilfe hat mich auf die Neuerscheinung hingewiesen: Angehörigenarbeit in der Suchthilfe von Larissa Hornig. Ich habe das Buch ohne große Erwartung erworben und es erst einmal mehrere Wochen ungeöffnet auf dem Schreibtisch liegen gelassen. Das war eine grobe Fehleinschätzung. Seitdem nun schmökere ich nahezu täglich darin und bin immer noch erstaunt über das, was ich geboten bekomme. Vorweg möchte ich klarstellen: Die Vielfalt und Vielschichtigkeit der Beschreibungen und Analysen von Hornig kann man in der Kürze einer Rezension nicht annähernd gerecht werden. Deshalb sollen nur einige wenige Highlights ihrer Arbeit skizzieren werden.
Zu den Inhalten: Das Buch ist quasi dreigeteilt: 1. Zunächst gibt Hornig einen geschichtlichen Abriss zu den Entwicklungen in Bezug auf die Angehörigenproblematik seit den 30ern des letzten Jahrhunderts bis heute und beschreibt ausführlich die Konzepte der Betroffenheit von Angehörigen bzw. von Co-Abhängigkeit. Sie stellt den Stand der Angehörigenarbeit in der Suchthilfe in Deutschland und den Forschungsstand zur Sache dar. 2. Des Weiteren stellt sie eine eigene Studie vor, in der sie Angehörige zur eigenen Problematik, ihren Erfahrungen mit dem und ihren Wünschen in Bezug auf das Hilfesystem mittels eines halbstrukturierten Interviews befragt hat. 3. Auf Grundlage der Konzepte und der eigenen Ergebnisse diskutiert sie vielfältige Verbesserungsvorschläge und Empfehlungen bezüglich der Praxis von Selbsthilfe und Suchthilfe, der Forschungssituation und der Gesundheitspolitik.
Mein Resümee zum Buch möchte ich kurzfassen: Hornig gibt den Angehörigen eine Stimme, frei nach Barnowski-Geiser "hört sie, was niemand sieht" (2009). Differenziert deckt sie den Entwicklungsbedarf von Praxis, Forschung und Politik in Hinblick auf die Angehörigenproblematik auf und spricht Klartext, wohin die Reise weitergehen sollte. Es ist ein intelligentes, sowohl praxisorientiertes als auch wissenschaftliches Buch, welches in einer Linie bedeutsamer Veröffentlichungen deutscher AutorInnen - Rennert, Lambrou, Arenz-Greivin, Klein, Barnowski-Geiser, Flassbeck - steht, diese aufgreift, vertieft und ausarbeitet. Die Texte sollten meines Erachtens zur Pflichtlektüre für Praktiker, Wissenschaftler und Gesundheitspolitiker werden.
Das letzte Wort aber möchte ich Larissa Hornig lassen und eine zusammenfassende Empfehlung und ihr abschließendes Fazit zitieren (S. 134-135, 140):
Folglich ist an dieser Stelle die notwendige Empfehlung abzuleiten, Fachkräfte in der Suchthilfe für die angehörigenzentrierte Sichtweise zu sensibilisieren und zu schulen, um die Belastungen und das Leiden Angehöriger beim Namen zu nennen und ihnen damit zu helfen - womit auch die, der vorliegenden Arbeit untergeordneten Fragestellungen, beantwortet werden konnten. Darüber hinaus sollte es unbedingt Gegenstand weiterer Forschung sein, die von Flassbeck begonnene Konzeptualisierung des Co-Abhängigkeitssyndroms für ein letztlich ausgearbeitetes Diagnosekonzept der Co-Abhängigkeit als eigenständige Störung weiterzuführen - um letztlich eine Innovation der Angehörigenarbeit zu beginnen.
Eine vor allem ausschlaggebende Erkenntnis aus der Literaturrecherche in Verbindung mit den empirischen Ergebnissen zum Begriff der Co-Abhängigkeit - entgegengesetzt meiner subjektiven Vorannahmen und der wohl von den meisten Wissenschafts- und Praxisvertreter:innen eingenommene Haltung, beruht auf dem deutlichen Potenzial des ursprünglichen Konstrukts und Ausgangspunkt dieses Begriffes.

2023-08 | Forschung | Studie
Demnächst halte ich einen Vortrag und gebe eine Fortbildung über die co-abhängige Betroffenheit von Suchthelfern. Bei der Recherche für die Veranstaltungen bin ich mal wieder über die Forschung der University of Bath zum Angehörigenthema "gestolpert". Die dortige Forschergruppe um Richard Velleman, Lorna Templeton und weiteren hat seit den 90ern spannende Studien zu den Belastungen von betroffenen Eltern, Partnern und Kindern durchgeführt (siehe auch » Fachliteratur, Rubrik Fachartikel).
Ein Artikel von Templeton, Zohhadi & Velleman von 2007 ist mir besonders aufgefallen. In der Machbarkeitsstudie wurden 13 MitarbeiterInnen von sieben Einrichtungen geschult, eine Kurzzeitintervention bei Familienangehörigen von Suchtkranken anzuwenden. Sowohl die Autorinnen als auch die MitarbeiterInnen und die 20 Familienmitglieder, welche in den Genuss der Intervention kamen, werteten übereinstimmend die Maßnahmen als gewinnbringend aus. Dennoch ziehen die AutorInnen am Ende nachstehendes negatives Fazit:
"However, organizational and commissioning issues mean that routine delivery of such an intervention may not yet be possible, until full recognition is given to the view that addiction problems are best dealt with in a more holistic way that takes into account the family context within which most people live."
In Großbritannien scheint sich die klinische Situation genauso defizitär wie auch in Deutschland darzustellen, dass wenig Bewusstsein für die familiären Zusammenhänge besteht, die Suchthilfe überwiegend symptomorientiert arbeitet und die gesundheitspolitischen Strukturen die Etablierung von angehörigenbezogenen Angeboten unzureichend fördern. Doch ein Aspekt unterscheidet die beiden Länder: Auf der Insel gibt es systematische wissenschaftliche Empirie und Aufklärung zur Problematik der erwachsenen Angehörigen, in Deutschland hingegen kaum.
Zu den Veranstaltungen bin ich übrigens von Einrichtungen der Suchthilfe eingeladen worden. Ich freue mich auf einen wertschätzenden, kritischen Diskurs über unsere Betroffenheit als Vertreter eines verstrickten Systems.
Templeton, L. J., Zohhadi, S. E. & Velleman, R.D.B. (2007). Working with family members in specialist drug and alcohol services: Findings from a feasibility study. Drugs: Education, Prevention and Policy, 14 (2), 137-150.
» Abstract einsehen
2023-04 | Altenkirchen | Fortbildung
Am 21. und 22.04.2023 absolvierten wir den zweiten Teil der Fortbildung "Behandlung des Suchttraumas" in Altenkirchen. Die Veranstaltung umfasste vier Tage und fand in Kooperation durch die Suchtpräventionsstelle der Diakonie Altenkirchen, der Suchtprävention des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung in Rheinland-Pfalz und mir als Referent statt. Die TeilnehmerInnen kamen aus Suchtpräventions- und Suchtberatungsstellen in Rheinland-Pfalz. Einige von ihnen sind spezialisiert auf die Arbeit mit suchtbelasteten Kindern und/oder erwachsenen Angehörigen, andere arbeiten sowohl mit Suchtbetroffenen als auch mit Angehörigen.
Im ersten Teil der Fortbildung, der Ende 2021 stattfand, wurden grundlegende Kompetenzen der Diagnostik, Analyse und Behandlung vermittelt. Den darauf aufbauenden zweiten Teil der Fortbildung habe ich unter das Motto "Loslassen und Raum geben" gestellt. Die anwendungsbezogene Vermittlung der Inhalte und Kompetenzen wurde durch Übungen zur Selbsterfahrung angereichert. Folgende Methodik der Beratung/Therapie bei suchttraumatisierten (erwachsenen) Kindern und anderen suchtbetroffenen Angehörigen wurde vertieft:
Beziehungsgestaltung
Problemverständnis, Motivation, Ziele
Abbau von co-abhängigen Verhaltensmustern und Erlernen unabhängiger Skills
Disputation von abhängigen Einstellungen und Stärkung von selbstbestimmten Überzeugungen
körperorientierte Erlebensaktivierung, Atemtherapie, Selbstkontakt
Emotionsfokussierte Methoden (Angst, Wut, Trauer, Scham)
Traumabewältigung, Kontakt zum inneren verletzten Kind
Dadurch dass alle TeilnehmerInnen aus der Praxis kamen, hatten wir vier intensive und lehrreiche Tage des Austauschs und Ausprobierens. Als positiver Nebeneffekt der Veranstaltung konnte die schon bestehende Vernetzung in Rheinland-Pfalz ausgebaut werden. So hat sich eine Intervisionsgruppe zur Fallbesprechung und zum Austausch über angehörigenbezogene Themen gegründet, welche alle drei Monate online stattfindet.
Mein Ziel war es, eine praxisorientierte und zertifizierbare Fortbildungskonzept zu entwickeln und auszuprobieren, durch welche Fachkräfte gezielt geschult werden können, traumatisierte Kinder aus Suchtfamilien und andere psychisch erkrankte Angehörige bedarfsgerecht zu unterstützen. Dies ist uns in Altenkirchen - auch und vor allem durch die fruchtbare Kooperation von Suchtprävention, Landesamt und Psychotherapeut - voll und ganz gelungen. Mein Traum ist es, die Fortbildung in Kooperation mit einem geeigneten Träger bundesweit anzubieten, um Qualitätsstandards in der angehörigenzentrierten Arbeit zu etablieren. - Ich bin gespannt, wie es in der Sache weitergehen wird.
Auf der Seite Materialien von Co-ABHAENGIG.de finden Sie unter der Rubrik Behandlung des Suchttraumas Arbeitsmittel, die in der Fortbildung genutzt und auf Grundlage des Fachbuches Die langen Schatten der Sucht (Flassbeck & Barth, 2020) entwickelt wurden.
» Arbeitsmittel zur Behandlung des Suchttraumas
» Behandlungskonzept Suchttrauma
2023-04 | Film | Rezension
Eine Betroffene, Mutter eines drogenabhängigen Sohnes, hat mir den Film empfohlen. Er beruht auf einer wahren Geschichte eines Vaters und seines drogenabhängigen Sohnes an der Westküste der USA (San Francisco, Los Angeles). Das Besondere ist, dass das Drehbuch auf den Erzählungen beider basiert, welche jeweils in Romanen niedergeschrieben wurden: "Beautiful Boy: A Father´s Journey Through His Son´s Addiction" von David Sheff und "Tweak: Growing Up on Methampetamines" von Nic Sheff.
Der Film wechselt ständig zwischen den Perspektiven von David und Nic. Die Filmszenen sind in Bezug auf den Sohn chronologisch geordnet, springen in Bezug auf den Vater indes in der Zeit hin und her. Die Rückblenden erzeugen einen noch tieferen emotionalen Einblick in das Erleben des Vaters. Der Zuschauer gerät so immer tiefer in den Strudel der eskalierend zerstörerischen Drogensucht von Nic und dem ebenso zerstörerischen Unterfangen des Vaters, den Sohn zu retten.
Die atmosphärische Dichte des Films wird durch den eher zurückhaltenden Einsatz von Sprache und durch die Inanspruchnahme von bis ins Detail ausgestalteten Kulissen, Musik, Landschaftsaufnahmen, Bildern und Symbolik verstärkt. Z.B. kommt der gleichnamige Song von John Lennon Beautiful Boy im Film vor. Das Lied handelt von einem Vater, der seinen Sohn nach einem Alptraum tröstet: "Close your eyes - Have no fear - The monster′s gone - He's on the run and your daddy′s here".
Zurück zum Filmplot: David wacht schließlich aus der Endlosschleife seines wahr gewordenen Alptraums auf. Als er von seinen verzweifelten Bemühungen loslassen kann und sich vom Sohn abgrenzt, erfährt die Geschichte eine dramatische Wendung.
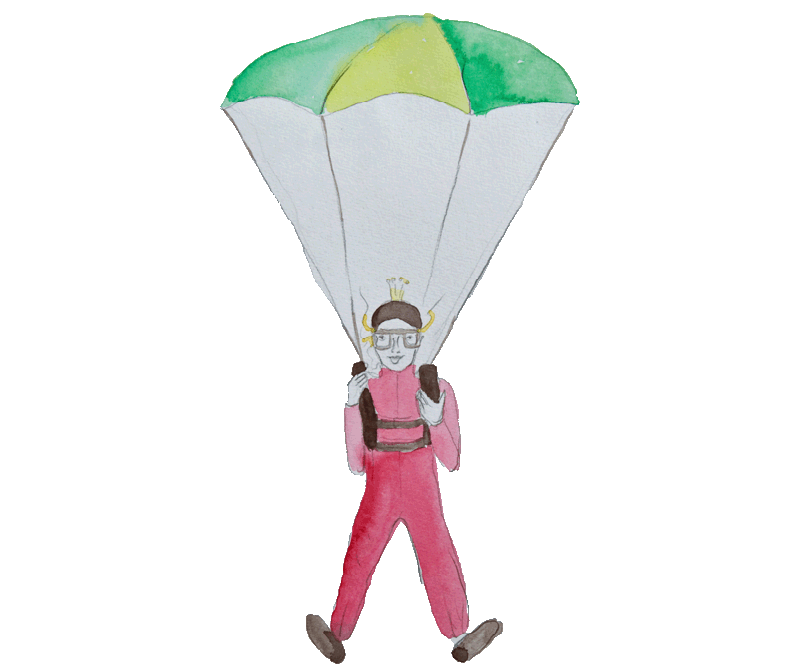
2023-03 | Co-ABHAENGIG.de
Seelische Verletzungen sind schwer sprachlich zu fassen. Kreative, künstlerische Ausdrucksformen helfen, einen Zugang zum Schmerz zu finden sowie die Sprachlosigkeit abzumildern. Nicht wenige suchtbetroffene Angehörige schreiben oder malen, um ihre leidvollen Erfahrungen zu verarbeiten. Dies ist eine große Ressource und ich bin oft beeindruckt von den kleinen Kostbarkeiten, welche Angehörige mir zusenden oder welche KlientInnen mit in die Therapie bringen. Nicht selten bin ich der erste Rezipient und bleibe auch der einzige. Das ist schade. Schon länger beschäftigte mich der Gedanke, ob und wie man diesen Werken eine Bühne bieten kann. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Co-ABHAENGIG.de hat eine neue Seite erhalten: Versform.
Ich danke den DichterInnen herzlich für ihre Beiträge. Dreierlei Zweck soll damit verfolgt werden:
Die Verse wollen Betroffenen einen Spiegel für die eigene Verletztheit und Verletzbarkeit bieten und darüber das furchtbare Gefühl des Abgetrenntseins abmildern, ganz allein mit der leidvollen Problematik auf der Welt zu sein.
Sie wollen berühren und das - auch und vor allem emotionale - Verständnis der Angehörigenproblematik bei Interessierten und Fachmenschen vertiefen.
Sie können in Prävention, Beratung und Therapie eingesetzt werden, um anderen Betroffenen einen Spiegel vorzuhallten und andere Menschen für die Angehörigenproblematik der Sucht zu sensibilisieren.
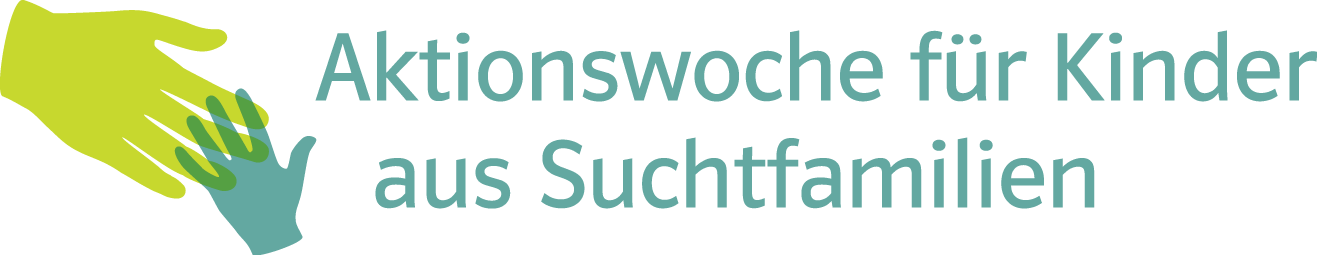
2023-03 | NACOA | COA-Aktionswoche
NACOA Deutschland e.V. hat sich bei allen bedankt, die sich an der Aktionswoche 2023 beteiligt und den Kindern aus Suchtfamilien eine Stimme gegeben haben. Insgesamt habe es bundesweit über "120 kreative und vielfältige Aktionen" gegeben. Aus den Fotos und Videos der erstmaligen durchgeführten Social Media-Kampagne #schlussmitdemstigma wurde ein Film erstellt, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, das Tabu zu brechen. Auch wurde auf der Website der Aktionswoche ein Pressespiegel mit Beiträgen in Radio und Fernsehen zusammengestellt.
Als jemand, der schon seit vielen Jahren mit Überzeugung und Engagement an der Aktionswoche teilnimmt, denke ich, dass das Thema der erwachsenen Kinder aus Suchtfamilien und auch anderer Angehöriger in der Woche zu wenig Beachtung findet. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass der WDR 5-Beitrag "Co-Abhängigkeit: Mitgefangen in der Sucht der Anderen", an dem Chandika Loh, Jil Rieger und ich beteiligt waren, Eingang in den Pressespiegel gefunden hat. - Schauen bzw. hören Sie selbst herein!
2023-02 | COA-Aktionswoche | Workshop
Im Rahmen der COA-Aktionswoche vom 12. bis 18.02. habe ich einen eintägigen Workshop gegeben: "Reden, fühlen, trauen". Geladen waren psychotherapeutische KlientInnen, die durch eine Kindheit in einer Suchtfamilie traumatisiert sind. Teil der dissoziativen Symptomatik ist, dass sich die Betroffenen allein und abgetrennt fühlen und nicht über ihr Erleben sprechen können. Sie sind gefangen im stillen Leiden. Der Workshop sollte dazu dienen, Öffentlichkeit herzustellen, Abgetrenntheit abzumildern und Raum für Begegnung und Austausch zu geben. Er war inhaltlich dreigeteilt:
Scham, Schweigen und Annahme
Trauer, Verletztheit und Trost
Wut, Sehnsucht und Lebenslust
In vor allem Paar- und Kleingruppenarbeit wurde Raum gegeben, miteinander zu schweigen, zu reden, sich gegenseitig zuzuhören und sich zu verstehen. Eine Teilnehmerin meldete am Ende zurück, mit ganz viel Angst gekommen zu sein und das erste Mal in ihrem Leben über ihre Vergangenheit und Verletztheit geredet zu haben. Sie drückte Erleichterung und Erstaunen darüber aus, in den anderen einen Spiegel ihrer selbst gefunden zu haben. Eine andere Teilnehmerin lachte und weinte gleichermaßen zum Abschluss, weil sie soviel Wertschätzung erfahren habe, was sie noch nicht einzuordnen wisse.
Für mich als Psychotherapeut war es eine berührende Erfahrung, wie die TeilnehmerInnen über ihren eigenen Schatten gesprungen sind. Betroffene, die nicht weinen können, nicht wütend werden können, keine Nähe eingehen können oder sich selbst ablehnen, haben im Verlauf des Workshops wie selbstverständlich geweint, sind laut geworden und haben es genossen, anderen nahe zu sein und Annahme zu erfahren. - Selbsthilfe ist die beste Hilfe. Die TeilnehmerInnen haben sich verabredet, um über die Gründung einer Selbsthilfegruppe zu sprechen.
Um Ihnen einen Einblick in die Therapie des Suchttraumas zu geben, ist der Impuls Wütender Lebenshunger angehängt, der als Fragestellung für den dritten Teil des Workshops diente. Nutzen Sie ihn gerne, um Ihre Lebenslust und -unlust zu explorieren.
2023-02 | Bundesweit | COA-Aktionswoche
Vom 12. bis 18.02. findet die bundesweite Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien unter dem Motto "Vergessenen Kindern eine Stimme geben" statt. Folgendes Zitat stammt von der Website der COA-Aktionswoche und informiert umfassend über Ablauf, Inhalt und Zweck:
Ziele der COA-Aktionswoche: Kinder aus suchtbelasteten Familien sollen gehört und gesehen werden. Mit der COA-Aktionswoche rücken wir Kinder aus suchtbelasteten Familien eine Woche lang in den Fokus der Öffentlichkeit und der Medien, damit deutlich wird: Mehr als 2,6 Millionen Kinder in Deutschland leiden unter Suchtproblemen ihrer Eltern. Wir, das ist zum einen der Verein NACOA Deutschland, der die COA-Aktionswoche bundesweit organisiert – aber natürlich auch alle Mitmachenden, wie Vereine, Initiativen, Organisationen, Anlaufpunkte, COA-Hilfsangebote, Selbsthilfegruppen u. v. m.
Während der COA-Aktionswoche – immer rund um den Valentinstag am 14. Februar:
sensibilisieren wir Menschen, die mit Kindern arbeiten (Erzieher*innen, Lehrer*innen, Sporttrainer*innen, Jugendgruppenleiter*innen, Ärzt*innen etc.), Kinder aus suchtbelasteten Familien zu erkennen.
stellen Projekte und Initiativen mit Aktionen und Veranstaltungen ihre Arbeit vor.
machen wir Hilfsangebote öffentlich.
fordern wir politisch Verantwortliche von Gemeinden bis in den Bund auf, sich für mehr Unterstützungsangebote für COAs einzusetzen und diese Hilfen langfristig zu finanzieren.
Die COA-Aktionswoche gibt es seit 2011 in Deutschland und in den USA. Außerdem findet sie z.B. regelmäßig auch in Großbritannien, der Schweiz, in Korea oder Slowenien statt.
2023-02 | WDR 5 | Podcast
Die Journalistin Laura Mareen Janssen hat für WDR 5 einen Podcast erstellt: "Co-Abhängigkeit: Mitgefangen in der Sucht des Anderen". In dem Feature kommen die beiden selbstbetroffenen Expertinnen Chandika Loh und Jil Rieger und auch ich als Psychotherapeut zu Wort. Frau Janssen hat die Inhalte der drei Interviews dramaturgisch so kunstvoll miteinander verwoben, dass ein informatives, umfassendes und gut zugängliches Bild zum Thema entsteht, welches gleichermaßen Selbstbetroffene, Fachleute als auch am Thema Interessierte anspricht. Rundum gelungen und hörenswert, wie ich finde! Der Podcast wird am Montag den 13.02. in der Sendung Neugier genügt zwischen 10:04 und 12:00 auf WDR 5 ausgestrahlt und ist auf der WDR 5-Seite aufrufbar. Aus der Anmoderation des Radiobeitrags:
Co-abhängige Menschen sind in der Regel Kinder, Partner:innen oder Freunde von Suchtkranken. Viele von ihnen leiden sehr unter dem Miterleben der Sucht und nicht selten führt das zu gesundheitlichen Schäden, berichtet Laura Mareen Janssen.
Einen Menschen lieben, der suchtkrank ist. Chandika Loh und Jil Rieger haben das beide erlebt. Bei Jil war es die erste große Liebe mit Anfang 20. Chandika heiratet ihren Partner und bekommt 2 Kinder. Das war 1985. 37 Jahre liegen zwischen den Erfahrungen der beiden. Und doch gibt es da diese dunklen Momente im Zusammenleben mit ihren Partnern, die beide kennen: die emotionalen und auch körperlichen Übergriffe, die mit jedem Konsum normaler werden. Und auch das Hoffen, dass alles besser wird, wenn man das Suchtproblem des anderen in den Griff bekommt.
2023-02 | Rohde, Rieger | Podcast
In seinem Podcast "Schnacken mal anders" unterhält sich Lukas Rohde mit Jil Rieger über ihre co-abhängigen Erfahrungen: "Jil Rieger - Co-Abhängigkeit - Sucht betrifft immer mehr als eine Person". Jil Rieger beherrschte die Kunst, ihre belasteten Lebenserfahrungen in unprätentiöse Worte zu kleiden. Sie macht es sich schwer, damit es leicht wird. Ihre Ausführungen sind authentisch, intelligent und überfordern nicht. Lukas Rohde macht es richtig, indem er durch seine Frage zwar inhaltlich ein wenig steuert, doch ihr dabei viel Raum für die narrative Entfaltung lässt. Eine Betroffene, der ich die Sendung empfohlen habe, meldete mir zurück, durch Jil Rieger verstanden zu haben: "Selbstlosigkeit ist auch eine Sucht. Eigentlich ist es dasselbe, nur in einer Form." Hören Sie mal rein und bilden Sie sich selbst eine Meinung!
Übrigens, Jil Rieger unterhält einen eigenen Podcast zum Angehörigenthema: Liebling, wir sind abhängig!.
» Podcast Schnacken mal anders
» Podcast Liebling wir sind abhängig!
2022-12 | NACOA | Website
NACOA Deutschland, die Interessenvertretung für Kinder aus suchtbelasteten Familien, startet eine neue Internetplattform als Informations- und Beratungsangebot in altersgerechter Sprache. Wie kommen Kinder und Jugendliche von suchtkranken Eltern an Informationen und Hilfsangebote? Wie erreicht man sie im Internet um Ihnen zu zeigen, dass Sie nicht alleine sind? Wie finden sie Wege aus der Krise?
NACOA hat sein bisheriges Angebot für diese Zielgruppe überarbeitet und bietet nun unter dem Motto "Trau Dir!" altersgerechte Informationen an. Comics aus dem Alltag und Hörbeispiele mit Berichten von Betroffenen zeigen die unterschiedlichen Rollen, die Kinder als Folge der Suchtkrankheit der Eltern einnehmen. Die Betroffenen werden motiviert, sich anderen in ihrer Not anzuvertrauen, und es werden ihnen konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, sich Hilfe zu holen.

2022-12 | Weiße Weihnacht
Weiße Weihnacht ist eine Kampagne, ein Zeichen der Solidarität mit den Kindern aus Suchtfamilien zu setzen und über die Festtage auf Alkohol zu verzichten. Für viele der drei Millionen suchtbelasteten Kinder in unserem Land ist aktuell die schlimmste Zeit des Jahres. Advent, Weihnachten und Silvester sind für sie verbunden mit Vernachlässigung, Streit und Gewalt. Weitere fünf bis sechs Millionen erwachsene Kinder aus Suchtfamilien stecken entweder noch mitten in der Sache drin oder, falls sie sich befreien konnten, werden von ihren traurigen Erinnerungen heimgesucht. Meine Gedanken sind ebenso bei den weiteren Angehörigen, denen die suchtbegründeten Sorgen und Nöte die Festzeit verderben.
Weiße Weihnacht verstehe ich als einen Gegenentwurf zum gesellschaftlichen Konsum- und Harmonierausch dieser Tage und steht für nüchterne Besinnung. Weniger ist bekanntlich mehr! Gönnen Sie sich Augenblicke des Innehaltens. Eine kleine adventliche Achtsamkeitsübung möchte ich Ihnen vorschlagen: Machen Sie einen mehr oder weniger ausgiebigen Spaziergang durch die Kälte und Dunkelheit dieser Tage. Danach erfreuen Sie sich mit einer warmen Tasse Kräutertee in der Hand daran, einer Kerze zuzusehen, wie sie in aller Seelenruhe herunterbrennt. Dies schafft die innere Voraussetzung dafür, an den Advents- und Festtagen sich selbst und anderen Momente ungeschminkter Zuwendung und Aufmerksamkeit zu schenken. Gemeinsam, nüchtern und besonnen singt es sich viel schöner unter dem Weihnachtsbaum.
Machen Sie mit bei Weiße Weihnacht und erklären Sie Ihre Teilnahme und Unterstützung auf der verlinkten Website.
2022-11 | BARMER | Interview
In schon 2020 hatte ich ein Interview zur Angehörigenproblematik mit einer Journalistin, die dieses im Auftrag der Barmer führte. Die Angelegenheit habe ich aufgrund der Corona-Krise aus den Augen verloren. Um so erstaunter war ich nun, als ich durch eine Zuschrift über den Beitrag gestolpert bin: "Co-Abhängigkeit: Mit Sucht umgehen als Angehöriger". Da es mir gut gefällt, wie die Internetredaktion der Barmer die Informationsfülle des Interviews in Szene gesetzt hat, ist es folgend verlinkt.
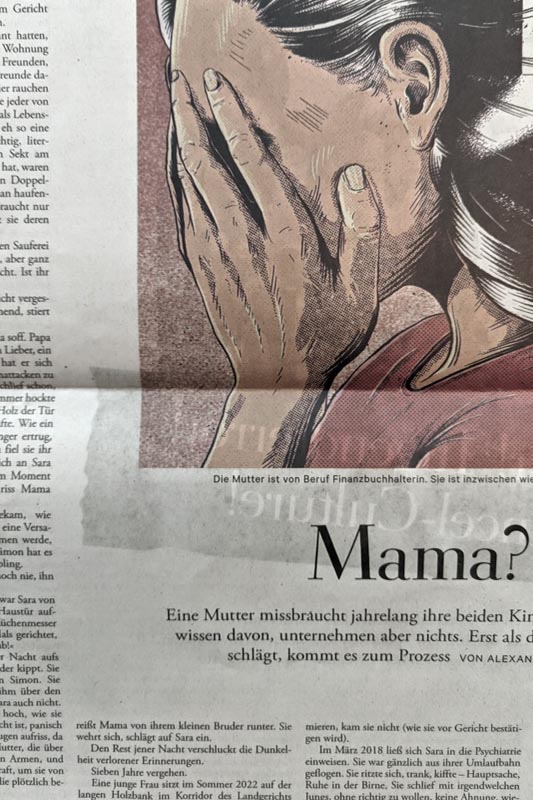
2022-11 | ZEIT | Artikel
In der ZEIT vom 10. November 2022 wurde ein Artikel zum Thema der Kinder aus Suchtfamilien publiziert (S. 20). Der Artikel "Mama?" ist meines Erachtens gut recherchiert und er wurde treffenderweise in der Rubrik Verbrechen gebracht. Sara und ihr jüngerer Bruder wurden durch die alkoholkranke Mutter jahrelang missbraucht. Die Behörden wussten davon, unternahmen aber nichts. Als junge Frau, obgleich psychisch krank, traut sie sich, die Mutter anzuzeigen. Ich danke dem Journalisten, Alexander Rupflin, für den ungeschminkten, schonungslosen Text und empfehle allen, die nicht zu zartbesaitet sind, die Ausgabe der ZEIT zu erwerben, um ihn zu lesen. Online konnte ich den Artikel bedauerlicherweise nicht finden, sodass er nicht verlinkt ist.
Seit ungefähr zwei Jahrzehnten bin ich treuer ZEIT-Leser. Es ist der erste Beitrag, den ich zum Thema in der ZEIT entdeckt habe. Bitte, bitte, liebe ZEIT-Redaktion, bringt das sowohl individuell tragische als auch gesellschaftlich brisante Thema häufiger. Es benötigt motivierende, kritische Öffentlichkeit, damit die Gesundheitspolitik und die Hilfesysteme endlich ihre diesbezügliche Missachtung und Trägheit überwinden und der Not der Betroffenen angemessen tätig werden. Vernachlässigkeit und Übergriffigkeiten, wie sie Sara und ihr jüngerer Bruder erfahren haben und aktuell drei Mio. Betroffene tagtäglich erfahren, sind oftmals juristisch, doch stets moralisch ein Verbrechen. Unterlassene Hilfe durch Missachtung und Untätigkeit, gleichgültig ob es von einzelnen Personen, Institutionen oder der Gesellschaft ausgeübt wird, ist in meinen Augen ebenso ein ethisches Verbrechen.
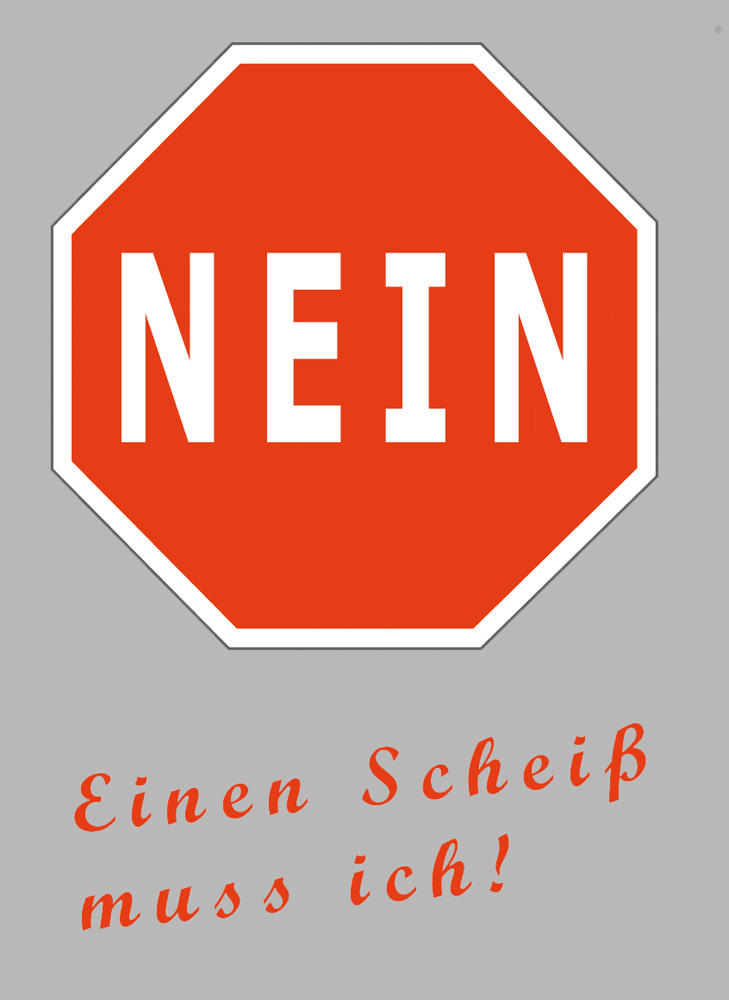
2022-10 | Warstein | Fortbildung
Im Oktober habe ich eine eintägige Fortbildung zum Thema co-abhängige Verstrickungen in der Suchthilfe gegeben. Ich bin gleich mehrfach positiv überrascht, dass das Fort- und Weiterbildungszentrum Warstein des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe dieses brisante und tabuisierte Thema angefragt hat, dass ausreichend MitarbeiterInnen der westfälischen Suchthilfe gekommen sind und die Veranstaltung stattgefunden hat sowie dass die TeilnehmerInnen, mehrheitlich aus der Sozialarbeit, ein Bewusstsein für die Problematik mitbrachten. Ich nehme an, dass genau die MitarbeiterInnen der Suchthilfe gekommen sind, die für das Thema offen sind. Den Workshop habe ich als ganz gewinnbringend erlebt und ich bin bereichert und optimistisch nach Hause gefahren.
Die Inhalte des Workshops sind kurz skizziert: 1. Suchtkranke bringen eine starke Zerissenheit oder Widersprüchlichkeit mit, die alle, die einen engen Kontakt haben und helfen wollen, herausfordert. Sucht ist eine Krankheit, aber es ist auch ein manipulatives, unsoziales und übergriffiges Verhalten. 2. Suchthelfer sind Menschen mit psychosozialen Neigungen und Problemen und können sich infolgedessen in den abhängigen Ambivalenzen und Manipulationen verstricken. Ich bezeichne es als co-abhängige Gegenübertragung, wenn Helfer die süchtige Devianz bagatellisieren und verleugnen, Sucht ausschließlich als Krankheit wahrnehmen und übermäßig helfen. 3. Verstrickungen können nicht verhindert werden, sie ergeben sich. Doch sie können genutzt werden. Es geht darum, sie aufzuspüren und geeignete Strategien der Grenzsetzung einzusetzen und die Unabhängigkeit als Helfer wiederherzustellen.
Darüber geschieht Entwicklung, auf Seiten der Suchthelfer und auch, falls sie sich einlassen, der Klienten. Deswegen ist es wichtig, dass Suchthelfer fortwährend ihr Berufsrisiko reflektieren (Kollegiale Beratung, Selbsterfahrung, Supervision) und flexibel sowohl Strategien des Helfens als auch der Abgrenzung einsetzen können. Eine gute Psychohygiene auf Seiten der Suchthelfer ist gleichbedeutend mit einer unabhängigen Beziehungsgestaltung und dies ist wiederum Voraussetzung für eine effektive und nachhaltige Suchthilfeleistung. Die Qualität der Psychohygiene und die der Hilfeleistung stehen in einer notwendigen Wechselwirkung und verstärken sich gegenseitig.
In der Vorbereitung der Fortbildung habe ich eine Tabelle als Hilfsmittel erstellt. Ich habe dabei entwurfsmäßig ausprobiert, den Zusammenhang der psychosozialen Auffälligkeiten der Sucht, der co-abhängigen Gegenübertragungen und der Alternativen der gesunden Abgrenzung herzustellen. Der Entwurf wurde durch das Erarbeitete im Workshop bestätigt und durch die Anregungen der TeilnehmerInnen konnte ich Dinge noch präzisieren. Für die TeilnehmerInnen und alle anderen Interessierten ist die Tabelle zum Herunterladen verlinkt.
» Tabelle: Süchtige Auffälligkeiten, co-abhängige Gegenübertragungen und gesunde Abgrenzung
2022-09 | Detmold | Vortrag
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Detmold feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Selbsthilfe ist wichtig und sie ist zentral. Jede Hilfe, gleichgültig ob Selbsthilfe, Beratung oder Therapie, ist im Kern Hilfe zur Selbsthilfe. Ein gut gemachtes Hilfeangebot basiert auf der Förderung von Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. Die Autonomie des Hilfesuchenden ist Ausgang, Methode und Ziel einer effektiven Hilfeleistung. Deswegen ist Selbsthilfe das Eigentliche.
Anders als im Bereich Sucht mangelt es an Selbsthilfeangeboten für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien und andere Angehörige. Deswegen freut es mich, dass die Kontaktstelle mich eingeladen hat, im Rahmen ihres Jubiläums einen Vortrag zu halten. Der Titel lautet: "Die langen Schatten der Sucht. Eine unglückliche Kindheit, ein unglückliches Leben?" Näheres über die Inhalte können sie in der verlinkten Ankündigung erfahren. Die Veranstaltung findet in Präsenz am Mittwoch 07.09. um 19:00 Uhr in der Kontaktstelle in der Bismarckstraße 8 in Detmold statt.
Nachschlag zum Vortrag, 09.09.2022: Es war schön, wieder einen Vortrag in Präsenz zu halten und unmittelbare, zwischenmenschliche Ressonanz zu erfahren. Das gesundheitspolitische Fazit meines Vortrags möchte ich hier festhalten, weil es auf den Punkt bringt, wo Entwicklungsbedarf besteht: Für betroffene Kinder und andere Angehörige wünsche ich mir, dass sich mehr Präventionskräfte, Pädagogen, Sozialarbeiter, Suchttherapeuten und Psychotherapeuten in der Behandlung des Suchttraumas qualifizieren und engagieren. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich die Millionen Betroffenen in der Selbsthilfe zusammentun, sich organsieren und vernetzen, Politik in eigener Sache machen, gesellschaftlich aufbegehren und lauthals Unterstützung einfordern. Denn Selbsthilfe ist das Eigentliche.
Das Honorar habe ich in Absprache mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle NACOA Deutschland gespendet.

2022-08 | Selbsthilfe | Kommentar
Die Apotheken Umschau hat einen Artikel über Co-Abhängigkeit mit einem Interview mit mir gebracht (s.u.). Daraufhin habe ich viele Zuschriften von Angehörigen erhalten, die sich gefreut haben, dass ihre Thematik aufgegriffen wurde. Sie haben sich durch den Artikel von Herrn Andrae und meine Interviewaussagen verstanden gefühlt. Ebenso viele haben mich angeschrieben, weil sie Hilfe suchen und meinen Rat hören wollten.
Ein Detail des Interviews betraf das 12-Schritte-Programm der Al-Anon, welches ich ambivalent bewerte. Einerseits schätze ich Al-Anon, weil sie immerhin eine Angehörigenselbsthilfe vorhalten, und andererseits gefällt mir am 12-Schritte-Program nicht, dass es religiös, autoritär und nicht mehr zeitgemäß ist. Über diese, meine Meinung waren einige unzufrieden und sie haben mir ihre anders lautende Sichtweise dargestellt. Gedanken sind bekanntlich frei und ich habe diese Bekundungen als Bereicherung erfahren. In zwei Fällen wurde ich sogar gefragt, wie ich zu einer solchen Bewertung komme. Daraus hat sich ein für beide Seiten gewinnbringender Austausch ergeben.
Nun habe ich von bekennenden AA, also Suchtbetroffenen, auch einige wenige unfreundliche Zuschriften erhalten. Sie schreiben genau in der Form, die ich als autoritär kritisiere. Der Duktus ist von oben herab und belehrend. Darauf möchte ich hier nicht eingehen. Ich lösche solche Emails und lass mir den Tag nicht verderben. Auch darauf, dass diese AA nicht bemerkt haben, dass es nicht um Sucht, sondern um die Angehörigenproblematik geht, will ich nicht weiter eingehen. Lieber gehe ich ein Eis essen!
Nur eins möchte ich vertiefen. Im Programm steht drei Mal das Wort Gott, zwei Mal ist die Sprache von Beten und es wird u.a. aufgefordert, sich der Sorge Gottes anzuvertrauen. Dennoch werde ich in den Zuschriften von AA zurechtgewiesen, dass ich das Programm falsch verstehe und es nicht religiös sei. Das Wort Gott würde für etwas Spirituelles stehen und jeder/jede sei frei, darunter zu verstehen, was er/sie möchte. Merken Sie den Widerspruch? Wenn ich dieser Einladung zur individuellen Auslegung nachkomme und das Wort Gott auf meine Art und Weise wortwörtlich und religiös begreife, dann liege ich in den Augen dieser AA falsch und werde verbal „gesteinigt“. Da passt etwas nicht.
Ich mag an Religion, dass alles Auslegung ist. Dies hat Religion mit Eissorten gemein, einer mag Schokolade, ein anderer Erdbeere und ein weiterer Vanille. Geschmack ist wie Glaube eine sehr subjektive Angelegenheit. Früher zu Zeiten der Kreuzzüge war dies anders, doch heute in demokratischen Zeiten darf jeder/jede glauben und an Eis wählen, was er/sie lieb hat. Das gefällt mir. Und noch eins, liebe AA: Religion ist im Kern durch den Glauben an einen Gott oder mehrere Götter definiert. Das Wort Gott meint Gott. Das ist nicht diskutierbar, sonst wird menschliche Kommunikation beliebig. Wo kommen wir hin, wenn wir religiös Gott sagen, indes spirituell Eis meinen?
Eins habe ich durch die belehrenden Zuschriften der AA verstanden. Dafür bin ich dankbar. Das 12-Schritte-Programm ist zur Behandlung von Sucht entwickelt worden. Es geht darum, süchtiges Unrecht und Fehlverhalten zu erkennen und die angerichteten Schäden - soweit möglich - wiedergutzumachen. Dafür ist das Programm geeignet und hat in den letzten Jahrzehnten einen guten Job gemacht.
Doch warum wurde es eins zu eins auf die Angehörigenhilfe übertragen? Kinder und Angehörige sind Opfer der Sucht. Sie helfen selbstlos und leiden unter übermäßigen Scham- und Schuldgefühlen. Ihnen wird Unrecht getan. Sie brauchen ein anderes, komplementäres Programm, welches sie anleitet, das ihnen angetane Unrecht zu erkennen, sich konsequent davon abzugrenzen und das eigene Leben wieder in die Hand zu nehmen. Das 12-Schritte-Programm zielt am Bedarf der Angehörigen vorbei. In der Kooperation mit Al-Anon-Gruppen habe ich erfahren, dass diese die Fehlausrichtung sehr wohl erkennen und korrigieren. Das ist gut so.
Zurück zum Thema des Artikels in der Apotheken Umschau: Es mangelt an Selbsthilfe für Angehörige. Das 12-Schritte-Programm ist keine Lösung dieses gesellschaftlichen Defizits. Für eine bedarfsgerechte, angehörigenzentrierte Selbsthilfe braucht es zeitgemäße, fachlich fundierte Konzepte, wie beispielsweise das AWOKADO-Konzept von Barnowski-Geiser (2015) oder mein Leben-zurück-Konzept (Flassbeck, 2021). Diesbezüglich sind alle Selbsthilfeverbände gefragt, sich zu engagieren und nachzubessern. Das wissenschaftliche AnNet-Projekt (Angehörigennetzwerk, 2017) hat übrigens vorgemacht, wie eine solche Selbsthilfe gelingen kann.
2022-07 | Interviews
Ende Juni und Anfang Juli haben das Magazin der Süddeutsche Zeitung und die Apotheken Umschau das Thema Co-Abhängigkeit aufgegriffen. Die Beiträge sind mit Interviews mit mir angereichert worden. Ich danke den JournalistInnen Frau Sara Peschke und Herrn Christian Andrae für die gelungene Kooperation. In beiden Artikeln wird das Thema in seiner leidvollen Tragweite und gesellschaftlichen Tabuisierung angemessen behandelt. Seitdem habe ich jede Menge Zuschriften von betroffenen Angehörigen und in der Angehörigensache engagierten Personen erhalten. Das erlebe ich sehr bereichernd. Zwei Dinge fielen mir dabei besonders auf.
Erstens suchen viele Angehörige Hilfe und wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen, weil es bei Ihnen vor Ort an speziellen Angeboten mangelt. Zweitens haben mich Selbsthilfestellen und auch Präventionsstellen auf ihre Hilfeangebote für Angehörige und Kinder aus Suchtfamilien hingewiesen. So habe ich erfahren, dass es in Erfurt eine gut aufgestellte Elternhilfe gibt, in München eine Selbsthilfe, die Sucht als Familienstörung versteht und entsprechend auch Angebote für Angehörige realisiert, und in Bochum eine Jugendhilfestelle mit besonderem Augenmerk auf Kinder und Jugendliche aus Suchtfamilien. Ich wünsche mir, dass sich diese Leuchtturmprojekte besser vernetzen würden, um an einem Strang in der Sache zu ziehen, sich gegenseitig zu bereichern und Vorbild für die vielen Regionen zu sein, die angehörigenbezogen unterversorgt sind.
» Apotheken-Umschau 24.06.2022
» Süddeutsche Zeitung Magazin 04.07.2022
(Bezahlinhalte)
2022-06 | Rezension | Neuerscheinung
Frau Dr. Barnowski-Geiser, die Autorin des Ratgebers "Vater, Mutter, Sucht" für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien, hat ein Buch über Krankheitsscham veröffentlicht. Krankheitsscham ist demnach ein Prozess, der allen somatischen und seelischen Krankheiten zugrunde liegt, den Krankheitsprozess verstärken und den Heilungsprozess hemmen kann. Wie Schamreaktionen in der Behandlung therapeutisch aufgegriffen und für die Genesung sogar genutzt werden können, wird in dem Buch differenziert dargestellt. Ich durfte das Werk für das Socialnet rezensieren.
Warum ist das Thema Krankheitsscham im Zusammenhang der Angehörigenthematik wichtig? Die Neigung, mit Scham auf Erkrankungen zu reagieren, ist stark von der biografischen Vorbelastungen abhängig, in der Kindheit beschämt, beschuldigt oder erniedrigt worden zu sein, was im Buch ausführlich dargestellt wird. Beschämung ist ein Trauma, welches Kinder in Suchtfamilien und auch andere Angehörige von Suchtkranken im Besonderen betrifft. Die Neuerscheinung ist daher auch ein wertvoller Gewinn, psychisch oder psychosomatisch erkrankte Angehörige zu verstehen und ihnen zu helfen.
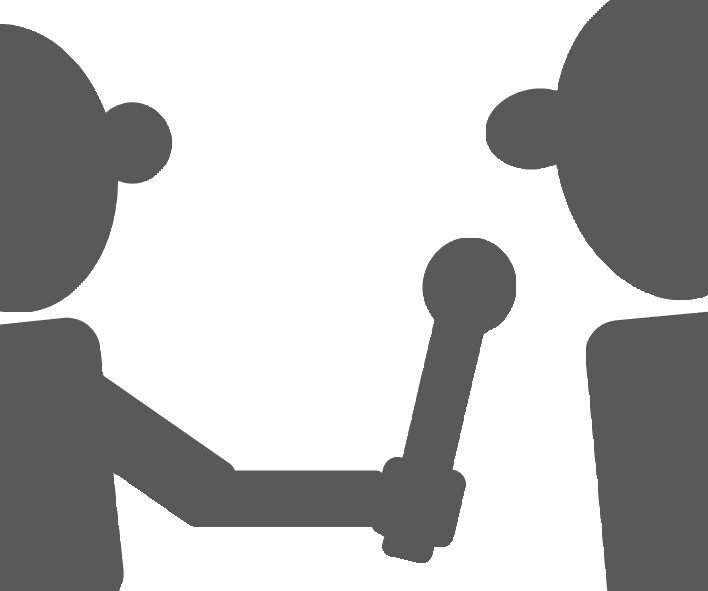
2022-06 | Co-ABHAENGIG.de | Neue Seite
Im letzten Jahr haben JournalistInnen gehäuft wegen Interviews zur co-abhängigen Thematik angefragt. Dies löst ambivalente Reaktionen in mir aus. Auf der einen Seite sind Interviews stressig und ich bin nicht gut darin, verstrickte Sachverhalte spontan, eloquent auf den Punkt zu bringen. Als Psychotherapeut kann ich besser Fragen stellen, als Antworten geben. Die JournalistInnen wünschen - verständlicherweise - prägnante Antworten und unterschätzen dabei die Komplexität der co-abhängigen Problematik und die gesellschaftliche Brisanz des Tabuthemas. Auf der anderen Seite benötigt die Angehörigensache Öffentlichkeit. Genau daran mangelt es. Das Engagement der JournalistInnen finde ich daher begrüßens- und unterstützenswert.
Angeregt durch die Interviews habe ich Co-ABHAENGIG.de mit einer neuen Seite versehen: Kurzgefasst. Hier habe ich die wichtigsten Fragen gesammelt und versucht, Antworten auf den Punkt zu bringen, damit Sie sich einen schnellen Überblick über die Angehörigenthematik verschaffen können.

2022-05 | NRW | RISKID
Die Landesregierung von NRW regelt als erstes Bundesland den Informationsaustausch bei Verdacht auf Kindesmisshandlung. Das Problem des Doctor-Hopping ist altbekannt: Wenn KinderärztInnen ihren Verdacht auf Misshandlungen ansprechen, verschleiern die Täter ihr Handeln, indem sie die Praxis wechseln. Dieselbe Täterstrategie wird auch bei Kita- und Schulwechseln angewendet.
Misshandlungen und Vernachlässigung ist allzu häufig mit Suchtmittelmissbrauch der Eltern assoziiert. Psychische Gewalt und Vernachlässigung haben alle meine psychotherapeutischen KlientInnen in ihrer Kindheit in einer Suchtfamilie erlebt. Geschätzt die Hälfte von ihnen war auch physischer und sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Eine besondere Schwere ist dadurch gegeben, dass Vernachlässigung und Übergriffigkeit gewöhnlich viele Jahre andauern, die Umwelt wegschaut und die Kinder keinen Schutz erfahren. Das Hilfesystem ist zwar bemüht, doch allzu oft hilflos.
Mit Hilfe des digitalen Informationssystems RISKID soll der interkollegiale Austausch von ÄrztInnen bei Verdachtsfällen erleichtert werden. Auch weitere Facharztgruppen wie z.B. GynäkologInnen, AllgemeinmedizinerInnen und Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen sind aufgefordert, sich zu beteiligen. In dem System können sich ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen wie in einer virtuellen Großpraxis über Befunde und Diagnosen austauschen, wenn unklar ist, ob bei einem Kind ein Missbrauch oder eine Misshandlung vorliegen könnte. Andere Institutionen wie Jugendämter oder Schulen sind vom Informationssystem aus Datenschutzgründen ausgeschlossen. RISKID ist meines Erachtens ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
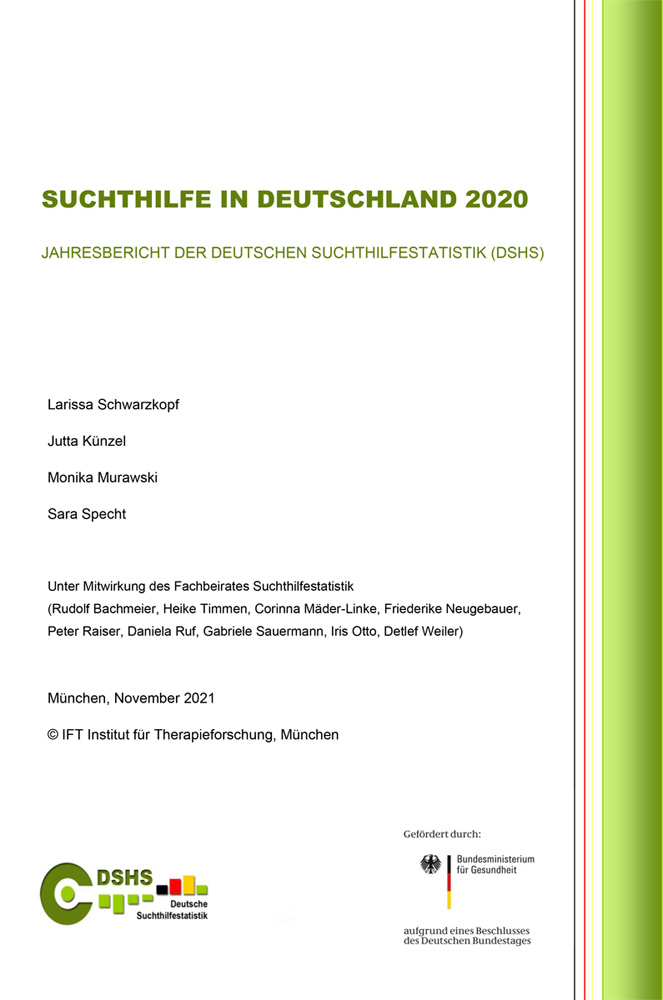
2022-05 | IFT Institut | Suchthilfestatistik
Die Deutsche Suchthilfestatistik (DSHS) ist das nationale Dokumentations- und Monitoringsystem im Bereich der Suchthilfe in Deutschland und wird jährlich durch das Institut für Therapieforschung (IFT) in München durchgeführt und publiziert. Ich habe mir das 204 Seiten starke Werk von 2020 vorgenommen (» Statistik als PDF) und nach Statistiken zu Angehörigen gesucht. Eine einzige Erwähnung der Angehörigen habe ich entdecken können (S. 17): 8% der Betreuungen fanden "mit Angehörigen oder anderen Bezugspersonen" statt.
Ob die Angehörigen eine eigene Beratung erhielten oder nur in die Betreuung der Suchtkranken einbezogen wurden, wird nicht in der Zahl aufgeschlüsselt. Darüber hinaus gehen in die Statistik sowohl kurze als auch lange Betreuungen gleichberechtigt ein. Es ist anzunehmen, dass Angehörige eher kurze Beratungen erhalten und die zeitintensiven Prozesse für die suchtkranke Klientel reserviert sind. Die Zahl der Angehörigenbetreuungen ist in Folge dessen beträchtlich, im unbekannten Maß nach unten zu korrigieren, um den wahren Aufwand der ambulanten Einrichtungen für Kinder und andere Angehörige einzuschätzen. 22 Jahre nach dem von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen ausgerufenen "Jahr der Angehörigen" darf man mithin von Systemversagen sprechen.
Drei weitere Stellen sind mir in Hinblick auf die Angehörigenproblematik in dem DSHS besonders ins Auge gefallen. In der Statistik zur Verteilung von Hauptdiagnosen in ambulanten Einrichtungen erfährt man (S. 18), dass nahezu die Hälfte der Klienten die Einrichtungen aufgrund alkoholbezogenen Störungen aufsucht (48%). Es folgen Störungen im Zusammenhang von Cannabinoiden (19,7%) und Opioiden (9,5). Allerdings gibt es in der Statistik keine Angaben zu Angehörigen, obgleich die meisten Suchtberatungsstellen heute Angehörigenberatung anbieten. Warum wird diese nicht ebenfalls erfasst?
Auf den Seiten 15 bis 17 werden die verschiedenen Angebote der ambulanten Einrichtungen und deren Kooperationen mit anderen Diensten quantifiziert. Zwar erfährt man, dass 90,8% der Einrichtungen Sucht- und Drogenberatung und 52,8% Prävention und Früherkennung anbieten sowie 72,3% der Einrichtungen mit der Selbsthilfe kooperieren, doch die Angehörigeangebote werden nicht erhoben. Warum nicht?
Neben den konsum- und verhaltensbezogenen Suchtproblemen werden weitere Problembereiche untersucht (S. 20). Die Hälfte der ambulanten Klienten gibt demnach psychische Probleme an und etwas zwei Fünftel schätzt die familiäre Situation als problematisch ein. Gewaltausübung wird indes selten berichtet (3,9%). Die AutorInnen gehen aufgrund der tabubesetzten Thematik von einer Untererfassung aus. Die Zahl spiegelt folglich die süchtige Verleugnung wieder. Warum wird nicht in Bezug auf die Opfer, also die Angehörigen, ergänzend nach Problembereichen wie z.B. Gewalt gefragt, um zu Daten zu gelangen, die die Realität eher abbilden?
Dem IFT Institut habe ich eine E-Mail mit meinen Fragen und Anmerkungen geschickt und tatsächlich schon am Folgetag eine freundliche und aufschlussreiche Antwort erhalten. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken! In der Antwort wird erstens der angehörigenbezogene Mangel der Statistik bestätigt, aber auf den Kernzweck der DSHS verwiesen, die Versorgung von Menschen mit Suchterkrankung mit Fokus auf leistungsrelevante Tatbestände darzustellen. Zweitens werden methodische Schwierigkeiten erläutert. Und drittens wird auf das Jahr 2027 verwiesen, in dem gegebenenfalls die Erhebung in Bezug auf die Angehörigen nachgebessert werden soll. Warten wir es ab!
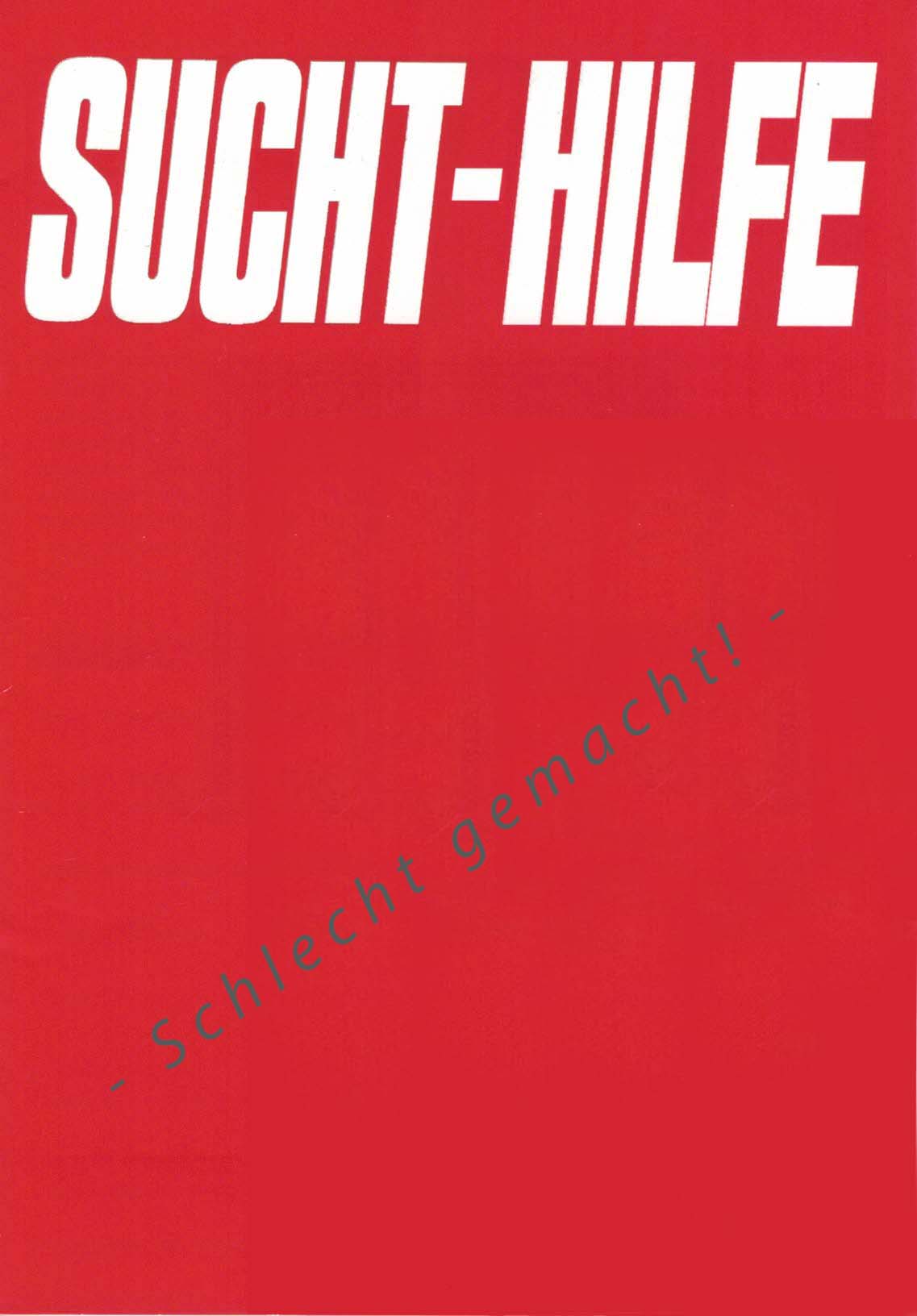
2022-04 | Sucht-Hilfe | Broschüre
Mir wurde von einer empörten Fachkraft der Jugendhilfe eine Broschüre einer Sucht- und Jugendhilfestelle in L. zugespielt. In dem "Ratgeber zur Aufklärung und Vorbeugung" (IV/22) gibt es auch einen Abschnitt zu "Sucht und Familie". Ich möchte Ihnen aus dem Text zitieren: "Aber wie sollen Angehörige reagieren? ... und sicher geht es Suchtkranken nicht darum, die Familie mit ihrer Sucht zu verletzen. Deshalb sollten Angehörige sich zunächst ausführlich über Suchterkrankungen, deren Ursachen und Auswirkungen informieren. ... Umso wichtiger ist es, die Beziehung jetzt nicht zusätzlich durch Vorwürfe, persönliche Kritik, Nörgeleien oder Beschimpfungen zu belasten... Ruhe und Verständnis mögen zwar schwierig sein, sind jedoch wesentlich, wenn Angehörige die Suchtprobleme thematisieren wollen... Eine solche belastete Atmosphäre erzeugt Stress und den werden die Suchtkranken wahrscheinlich in einer Flucht in die Sucht zu kompensieren versuchen. ... Wenn Suchtkranke sich öffnen und über ihre Erkrankung sprechen, sollten Angehörige sie nicht unterbrechen. ... Wer Suchtkranken helfen möchte, sollte stets konsequent sein, Grenzen ziehen und Vorbild sein."
Meinen die KollegInnen in L. ernsthaft, dass Angehörige, die ständig Abwertungen, Beschimpfungen, Beschuldigungen und Beschämungen ausgesetzt sind, Ruhe und Verständnis aufbringen sollen? Sollen sich Angehörige, wenn der Suchtkranke mal wieder die Haushaltskasse geplündert hat und kein Geld mehr für Essen da ist, zunächst einmal ausführlich über Suchterkrankungen und deren Auswirkungen informieren? Sollen Angehörige, nachdem sie psychisch oder physisch misshandelt wurden, nicht verletzt sein und den Suchtkranken nicht unterbrechen, wenn er sich öffnet und über seine Krankheit spricht? Und sollen Angehörige, die tagtäglich die Folgen der Sucht ausbaden und mit der belasteten Situation überfordert sind, den Stress verbergen, damit der Suchtkranke sich nicht in den Konsum flüchtet?
Die Broschüre löst bei mir ungläubige Sprachlosigkeit aus. Doch mir ist dazu eine Aussage einer Klientin eingefallen. Sie kommt aus einer Suchtfamilie, ist selber Sozialarbeiterin und hat ihre vielfältige Erfahrungen mit Beratungsstellen, Krisendiensten und Seelsorge wie folgt zusammengefasst: "Eigentlich suche ich jemanden, der mir einfach zuhört und Verständnis hat. Und dann geben mir die Kollegen oft dort Ratschläge, die ich nicht brauchen kann. An den Ratschlägen merke ich, dass sie nicht wirklich zuhören und keine Ahnung haben. Es erinnert mich an meine Familie. Die sagen mir auch immer, was ich denken, fühlen und tun soll. Aber keiner hört mir zu, keiner sieht mich."
Impuls: Es wäre eine Möglichkeit, gemeinsam mit geeigneten Kooperationspartnern eine angehörigenzentrierte Broschüre herauszugeben.

2022-02 | Drogenbeauftragte | Berlin
Am 11.02.2022, zwei Tage vor Beginn der Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien, hat sich der neue Drogenbeauftrage der Bundesregierung, Burkhard Blienert, in einem Interview mit der WELT zu Wort gemeldet. Wohlgemerkt äußert er sich nicht zur Aktionswoche, vielmehr fordert er eine Neuausrichtung der Drogenpolitik. In seinen Antworten kommt die Angehörigenproblematik nicht vor. Nachstehend zwei Zitate zu den zentralen Aussagen des Interviews: "Was wir brauchen, ist einen neuen gesellschaftlichen Umgang mit Drogenkonsum insgesamt. Wir müssen die Menschen unterstützen und ihnen helfen. Das steht für mich an allererster Stelle." und "Im Mittelpunkt sollte die Gesundheit stehen, nicht das Strafrecht. Drogenkonsumierende sollten nicht stigmatisiert werden, sondern Gehör und Akzeptanz finden." (» Interview)
Ich verstehe schon, dass Blienert seine Worte ermutigend und entstigmatisierend meint. Eine Neuausrichtung der Drogenpolitik kann ich nicht erkennen. Er setzt nur fort, was die Vorgängerinnen schon verfolgt haben. Allerdings ist die Wortwahl aus Angehörigenperspektive mehr als unglücklich zu bewerten. Aus Sicht der Angehörigen wird Folgendes nahegelegt: Drogenabhängige, die gewohnheitsmäßig täuschen, manipulieren, abwerten, beschuldigen und beschämen sowie nicht selten auch betrügen, klauen, misshandeln und missbrauchen, sollen gesellschaftlich "Gehör und Akzeptanz finden". Meint Blienert, dass wir das unsoziale und deviante Tun von Suchtkranken akzeptieren sollen? Selbstverständlich meint er dies nicht, aber er sagt es. Ein klassischer Freudscher Versprecher? Mitnichten! Das Gesagte spiegelt die längst überholte gesellschaftliche Schieflage wieder, dass die - allzu häufig suchtkranken - Täter alle Aufmerksamkeit und Hilfe erhalten und die Opfer - im Fall von Sucht v.a. Kinder, Partnerinnen und Eltern - vergessen werden.
Die offizielle Website des Drogenbeauftragten, wie ich recherchiert habe, spiegelt diese Missachtung der Angehörigen ebenfalls wieder. Auch diesbezüglich setzt Blienert die Tradition des Hauses fort. Aus Angehörigensicht und vor dem Hintergrund der aktuell stattfindenden COA-Aktionswoche hat der Drogenbeauftragte einen bedauerlichen Fehlstart ins neue Amt hingelegt. Schade auch, die Chance auf einen echten Neuanfang ist verpasst!
2022-02 | COA-Aktionswoche
Unter dem Motto "Wir brauchen Verlässlichkeit!" findet vom 13. bis 19. Februar 2022 die 13. bundesweite Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien statt. Organisiert wird die Aktionswoche von den beiden Vereinen NACOA Deutschland und Such(t)- und Wendepunkt e.V. In zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland werden wieder Einrichtungen, die mit betroffenen Kindern und Jugendlichen arbeiten, auf die leidvolle Situation der Betroffenen und die mangelhafte Versorgung durch die Hilfesysteme in Deutschland hinweisen - gerade auch in Zeiten der Pandemie.
NACOA lädt unter anderem zum Auftakt der Aktionswoche für den 11. Februar von 10:00 bis 11:30 Uhr zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit gesundheits- und drogenpolitischen ExpertInnen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ein. Die Veranstaltung findet kostenfrei online per ZOOM statt (» Veranstaltung). Die Interessenvertretung für Kinder aus suchtbelasteten Familien hebt gesundheitspolitisch hervor: "Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien kennen leider in ihrem Alltag die mangelhafte Verlässlichkeit von Verantwortlichen. Die Einhaltung von Verlässlichkeit ist ein hohes Gebot und deshalb sind sicher finanzierte Hilfs- und Beratungsangebote für diese hochverletzliche Gruppe so wichtig."
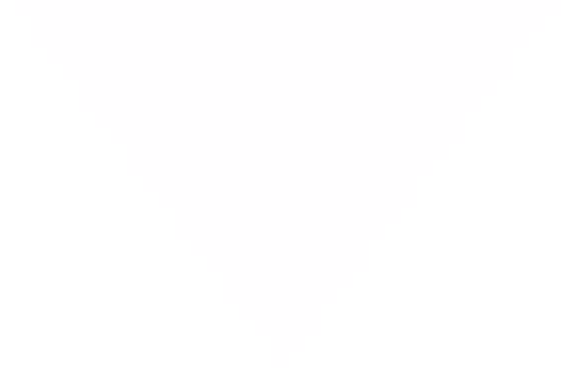
Obendrein: