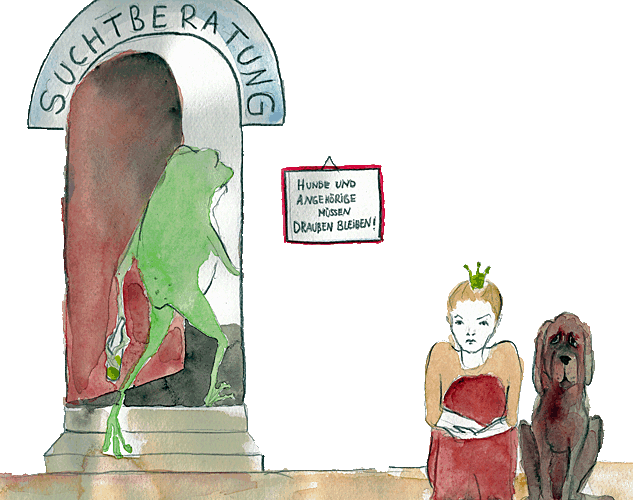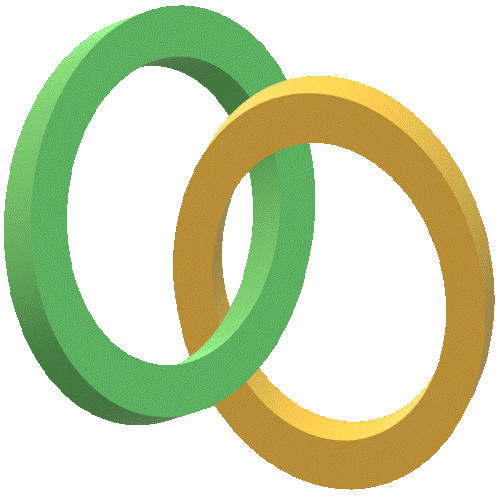2009 habe ich erstmalig über das Angehörigenthema auf einer Tagung referiert. Eigentlich war ich als Experte für ressourcenorientierte Suchttherapie angefragt gewesen, doch aus einer Laune heraus habe ich das Angehörigenthema gewählt. Frohen Mutes begann ich zum Thema zu recherchieren. Dabei stieß im Prinzip auf zweierlei Auffälligkeiten. Erstens fand ich ein großes Nichts. Zugegeben ist diese Bewertung rhetorisch übertrieben. Wer sucht, findet schon ein wenig. Jedoch stellen Sie bitte das Wenige, auf das Sie stoßen, in ein Verhältnis zu dem Überfluss, den Sie zum Themenkomplex Sucht und Suchtmittelkonsum finden. Die homöopathische Dosis des Angehörigenthemas ist in meinen Augen nichts.
Literatur: Abgesehen von alten Schinken aus den 80ern, die ich schon hatte, fand ich kaum neue Literatur. Die Bestseller zum Thema der Angehörigen von Schaef, Mellody, Beattie und auch die deutschen Publikationen von Monika Rennert und Ursula Lambrou stammen alle aus den 80ern des letzten Jahrhunderts, und zwar in unveränderter Auflage. Die genannten Werke sind alle gut, aber die Diagnose- und Behandlungskonzepte darin sind obsolet und es gibt keine Auseinandersetzung und Entwicklung. Mit den Büchern, die in den letzten 20 Jahren zum Thema Sucht publiziert wurden, kann vermutlich eine ganze Bibliothek gefüllt werden. Meine Sammlung zum Thema der Angehörigen ist beinah vollständig und füllt nicht einmal ein Regalbrett. Und es sind sogar einige Raritäten dabei, die ich mir extra von Antiquariaten aus Amerika habe schicken lassen.
Wissenschaft: Es gab und gibt keine systematische Forschung zum Thema der Angehörigen. Größtenteils fand ich Fachartikel, die in die Schublade "Theoretisches" oder "Philosophisches" fallen. Der geführte theoretische Diskurs ohne empirische Datengrundlage ist in meinen Augen abgehoben und sinnentleert. Das Jahr 2000 wurde von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) als "„Jahr der Angehörigen" ausgerufen. Der damalige Leiter der DHS formulierte selbstkritisch: "Was aber das Wichtigste ist: Wir müssen uns insgesamt lösen von der Fixierung auf den oder die Missbraucher/in, die oder den Abhängige/n. Auf der anderen Seite müssen wir dafür kämpfen, dass auch Angehörige die Hilfe bekommen, die erforderlich ist." Die Zeitschrift SUCHT wird unter anderem von der DHS herausgegeben. Ich habe die Jahrgänge 2000 bis 2010 der Zeitschrift inhaltlich gesichtet, um der Frage nachzugehen, ob das Jahr der Angehörigen Folgen auf die Forschung hatte. Das Ergebnis war ernüchtern: nur vier Artikel. Die DHS und die Suchtforschung sind bis heute weit davon entfernt, den eigenen, von Hüllinghorst formulierten Anspruch zu erfüllen.
Behandlungskonzepte: Damals, als ich für den Vortrag recherchierte, fand ich nur ein einziges ausgearbeitetes Behandlungskonzept für Betroffene: Das 12-Schritte-Programm (von Al-Anon und von Pia Mellody), umgesetzt für Angehörige. Ein auch heute noch beachtenswertes Konzept, welches allerdings nicht modernen Ansprüchen entspricht. Mittlerweile sind weitere Behandlungskonzepte hinzugekommen, die Sie aber noch an einer Hand abzählen können. Die allgemeine Konzeptlosigkeit drückt sich auch darin aus, dass in den typischen Broschüren, Ratgebern und Angehörigenseminaren, Angehörige ausgiebig über Sucht, Suchtmittel und Suchtmittelkonsum und die Folgen informiert werden. Angehörigenorientierte Inhalte sind dagegen rar. Im Bereich der Kinder in Suchtfamilien bewegt sich inzwischen ein wenig mehr. Doch muss klar sein, wir bewegen uns immer noch auf niedrigem Niveau und haben jede Menge Nachholbedarf.
Angebote: In der Suchthilfestatistik des Jahres 2009 stieß ich während meiner Recherchen auf eine kleine Statistik zu den Angehörigen: "Insgesamt suchten 6% Personen aufgrund einer Problematik eines Angehörigen die Suchthilfeeinrichtung auf. ... Die Mehrheit (57%) gab als Grund Alkohol-Probleme des Angehörigen an." Haben Sie es bemerkt? Die Angehörigen suchen demnach die Beratung nicht wegen eigener Probleme auf, sondern lediglich wegen der Probleme der Suchtkranken. Die Zahl von 6% ist schon niedrig, doch überschätzt sie die Realität. Angehörige erhalten üblicherweise nur kurze Kontakte. Die längeren Beratungs- und Therapieprozesse sind für die Suchtkranken reserviert. Zu vermuten ist des Weiteren, dass sehr häufig nicht die Probleme der Angehörigen in der Angehörigenberatung im Mittelpunkt stehen, sondern die Suchtproblematik. Die Angehörigen werden genutzt, um indirekt Zugriff auf den unwilligen Suchtkranken zu nehmen. Der tatsächliche Aufwand des Suchthilfesystems für Angehörige ist folglich beträchtlich, in unbekannter Höhe nach unten zu korrigieren.
Gesundheitspolitischer Auftrag: Trotz des immensen Leids von Angehörigen von Suchtkranken und Kindern aus Suchtfamilien als Folge der Sucht, gibt es bis heute keinen eindeutigen gesundheitspolitischen Auftrag an die Suchthilfe, sich um die Betroffenen zu kümmern. Darüber hinaus kranken wir als Suchthilfe daran, dass wir keinen Konsens in Bezug auf die Angehörigen zustande bringen. Wir benötigen ein gemeinsames Angehörigenparadigma, um die träge Politik herauszufordern und ihr einen klaren Auftrag abzuringen. Ich halte dies für entscheidend, sonst wird und kann jedes Engagement früher oder später nur im Sande verlaufen.
Ökonomie: Jeder Realist unter uns weiß, dass die Umsetzung von Hilfeangeboten stärker von der Finanzierbarkeit als von der Notwendigkeit oder der Qualität der Angebote bestimmt ist. Viele der kleinen, erfreulichen Projekte im Bereich der Kinder in Suchtfamilien sind finanziell nicht langfristig abgesichert, vielmehr werden sie zeitlich begrenzt durch Stiftungen ermöglicht. Einer Bekannten von mir wurde die unklare gesundheitspolitische Situation zum Verhängnis. Sie hat eine stationäre Einrichtung für traumatisierte Kinder aus Suchtfamilien aufgemacht. Das Projekt war sogar von der damaligen Drogenbeauftragten der Bundesregierung ausgezeichnet worden. Doch die Krankenkassen bewilligten keine einzige Kostenzusage. Langfristig betrachtet hätte sich das Angebot sicherlich gerechnet. Die Ausgaben hätten präventiv gesundheitliche Spätfolgen verhindert und darüber sich kumulierende Behandlungskosten eingespart. Ökonomisches Denken im Gesundheitswesens ist manchmal wenig nachhaltig.
Zwischenfazit: Suchthilfe, Suchtprävention, Suchtpolitik und Suchtforschung sind total fixiert auf den Themenkomplex Suchtmittelkonsum, Suchtgefahren und Suchtkrankheiten. Komplementär hierzu werden die Angehörigen und Kinder der Suchtkranken kaum beachtet. Der maßlose Überfluss an Aufmerksamkeit, Zeit, Hilfe und Geld, den wir den Suchtkranken schenken, führt zu einem Mangel auf Seiten der Angehörigen. Bezug nehmend auf Goffman beschneiden wir so die Angehörigen in ihrer Würde und Identität.